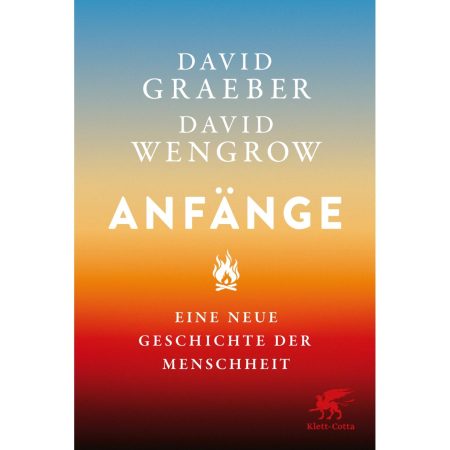Ein Buch für die Zukunft
Die Autoren zeichnen ein überraschendes Bild der Menschheitsgeschichte auf Basis neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse. Dabei leitet sie die Frage: Können wir die Freiheit wiederentdecken, die uns überhaupt erst zu Menschen macht? Ein Buch, das die Gegenwart neu erklärt und Potenziale für die Zukunft aufzeigt.
Dies ist ein Buch für Jäger und Sammler. Für alle Neugierigen, die Freude daran haben, von ungewöhnlichen Fragen auf neue Gedanken gebracht zu werden.
Zehn Jahre haben Graeber, der kurz nach Fertigstellung des Buchs verstarb, und Wengrow an diesem Opus Magnum geschrieben, das auf zuweilen verschlungenen und mit Beispielen und Geschichten reich bebilderten Wegen durch die Menschheitsgeschichte führt.
Dabei eröffnet es auf Grundlage neuer archäologischer und anthropologischer Erkenntnisse einen anderen Blick auf sicher geglaubte Wahrheiten der Geschichte des gesellschaftlichen Zusammenlebens und gibt damit mannigfaltige Inspiration für künftige Gesellschaftsformen.
Am Anfang der zehnjährigen Autorenschaft stand die Frage: Wo kommt Ungerechtigkeit her? Eine Frage, die alsbald verworfen wurde. Denn im Entstehen des Buchs zeigte sich, dass es weniger um Ungerechtigkeit geht als vielmehr um Unfreiheit, und dass es nicht den einen Ursprung der aktuellen gesellschaftlichen Verfasstheit gibt. Vielmehr wurden im Laufe der Geschichte vielfältige Möglichkeiten des Zusammenlebens praktiziert und verworfen.
Vielfalt an Gemeinschaften und Lebensformen
Graeber und Wengrow erzählen von Gesellschaften der letzten 30.000 Jahre, also vom Paläolithikum bis zur Neuzeit, in denen die Art des Zusammenlebens etwa nach den Jahreszeiten variierte: So lebte man für eine Zeit des Jahres als eine Art Dorfgemeinschaft zusammen, in einer anderen in verstreuten Gruppen von Jägern und Sammlern, je nachdem, was die klimatischen Gegebenheiten und die Bedürfnisse der Gemeinschaft erforderten.
Sie berichten von Gemeinschaften, die zwar ein Oberhaupt hatten, das aber mit keinerlei Befehlsgewalt gegenüber den anderen Mitgliedern ausgestattet war. Oder von Gemeinschaften, deren Mitglieder auf lange Reisen gingen, in der Gewissheit, in anderen, weit entlegenen Gemeinschaften freundliche Aufnahme zu finden – ganz ohne Handy.
Sie erzählen von Gemeinschaften, die auch heute noch ohne formelle Hierarchie auskommen, wie die San im südlichen Afrika. Wir erfahren von Gesellschaften, in denen Frauen eine maßgebliche Rolle spielten, ohne dass daraus das matriarchale Gegenstück eines Patriarchats resultierte.
Wir lernen den Staatsmann Kandiaronk aus dem nordamerikanischen Volk der Wendat kennen, dessen Kritik an der Lebensweise der französischen Kolonialisten wohl entscheidend zur europäischen Aufklärung im 18. Jahrhundert beigetragen hat, wenn nicht sie sogar ausgelöst hat.
Können wir Freiheiten wiederentdecken, die uns zu Menschen machen?
Die eigentliche Frage müsse also lauten, so Graeber und Wengrow: „Wo sind wir steckengeblieben und warum?“ Wo und warum sind wir stecken geblieben in einer Art des gesellschaftlichen Miteinanders, das uns offensichtlich immer weniger dient?
Oder, wie die Autoren es formulieren: „Warum haben sich einige menschliche Gesellschaften von den flexiblen und wechselnden Ordnungen entfernt, die für unsere frühesten Vorfahren offenbar typisch waren? Und warum konnten dadurch bestimmte Individuen oder Gruppen dauerhaft Macht über andere beanspruchen: Männer über Frauen, Alte über Junge und schließlich Priesterkasten, Kriegeraristokratien und Herrscher, die tatsächlich herrschten.“
Die Autoren maßen sich nicht an, darauf eine allgemeingültige Antwort zu geben. Vielmehr verweisen sie zum einen auf die zentrale Bedeutung von Freiheit: „Wenn, wie viele meinen, die Zukunft unserer Spezies heute von unserer Fähigkeit abhängt, etwas anderes zu schaffen (…), dann geht es letztlich um die Frage, ob wir die Freiheiten wiederentdecken können, die uns überhaupt erst zu Menschen machen.“
Wo ging den Menschen die Flexibilität verloren?
Dabei definieren Graeber und Wengrow vor allem drei Grundfreiheiten: die Freiheit, sich frei zu bewegen, die Freiheit, Befehle nicht zu befolgen, und die Freiheit, gesellschaftliche Beziehungen neu zu organisieren. Und zwar nicht nur als theoretisches Recht auf diese Freiheiten, sondern vielmehr als konkrete Möglichkeit, diese Freiheiten zu leben.
Zum anderen bieten sie Erklärungsvorschläge dazu an, wo uns Flexibilität und Freiheit verloren gegangen sein könnten: Sind die Menschen etwa steckengeblieben, weil sie es sich zur Angewohnheit gemacht haben, sich mehr in Abgrenzung von anderen Gruppen, Kulturen, „Stämmen“ zu definieren als sich auf die Gemeinsamkeiten als Menschen zu besinnen? Werden solche Abgrenzungen sowie Dominanzverhältnisse durch Gewalt und Kriege verfestigt?
Warum wurde das Privateigentum von einer einfachen Regelung darüber, wer was nutzen darf, zu einem Machtinstrument? Oder welche Rolle spielt das in Höfen, Palästen oder anderen Machtzentren vorherrschende Modell des patriarchalen Haushalts römischer Prägung, in dem Strenge und Züchtigung als Form der Liebe gelten und Kontrolle und Dominanz als Form der Fürsorge.
Neue Einsichten für die Zukunft gewinnen
Die Autoren kommen zur Conclusio: „Wie wir vermuten, ist die Verbindung (oder wahrscheinlich besser gesagt Verwechslung) von Fürsorge und Herrschaft ganz entscheidend für die relevantere Frage, wie wir Menschen die Fähigkeit verloren haben, uns selbst frei neu zu erschaffen, indem wir unsere Beziehungen untereinander neu gestalten.“
Die Fülle an Beispielen auf den insgesamt 560 Seiten der großformatigen gebundenen deutschen Ausgabe kann verwirrend sein und der rote Faden ist nicht immer leicht erkennbar. Es ist ein Buch, in dem man sich verlieren kann. Aber das macht letztlich auch seinen Reiz und seine Faszination aus.
Passt dieser „mäandrierende“ Charakter doch zum Inhalt und zur Intention, eine „neue Geschichte der Menschheit“ zu erzählen, die dazu geeignet ist, unsere Synapsen in alle Richtungen feuern zu lassen und aus all der Fülle neue Bilder für eine mögliche Zukunft der Menschheit zu entwerfen.
Sabine Breit
David Graeber und David Wengrow. Anfänge- Eine neue Geschichte der Menschheit. Klett-Cotta 2022. Der Originaltitel des Buchs lautet : The Dawn of Everything – A New History of Humanity.