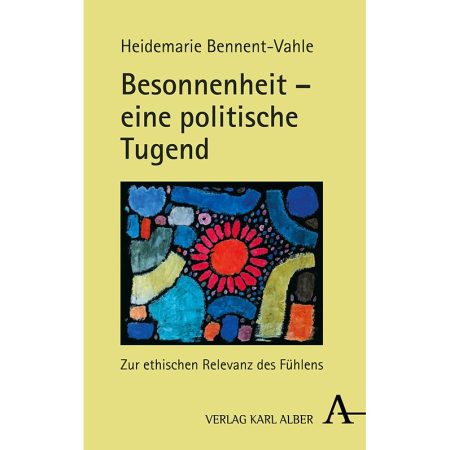Ein Buch der Philosophin Heidemarie Bennent-Vahle
Besonnenes Denken und Handeln sind heute wichtiger denn je, im Privaten und im Politischen. Heidemarie Bennent-Vahle, eine Philosophin, die sich vor allem der Praxis widmet, schreibt in diesem Buch, wie wichtig die Persönlichkeitsbildung auch für das Gelingen der Demokratie ist.
„Besonnenheit“ ist – neben Klugheit, Gerechtigkeit und Mut – eine der vier Kardinaltugenden der antiken Weisheitslehren. Die Philosophin Heidemarie Bennent-Vahle behandelt sie in ihrer gründlichen philosophischen Untersuchung als eine in besonderer Weise politische Tugend. Als solche ist sie gerade angesichts der aktuellen Entwicklung der öffentlichen Debatten in den westlichen Demokratien von großer Bedeutung ist.
Der Untertitel „Zur ethischen Relevanz des Fühlens“ stellt die Reflexionen der Autorin in den Kontext ihrer bisherigen Veröffentlichungen. In diesen ist der Mensch zentral als ein „denkfähiges Gefühlswesen“ angesprochen.
Das zentrale Anliegen des Buches ist nicht die Begriffs- oder der Kulturgeschichte der Besonnenheit. Vielmehr hat die Autorin, die auch eine philosophische Praxis betreibt, ein weniger akademisches Ziel: „Dieses Buch, das für Selbstformung und Kultivierung von Besonnenheit plädiert, wobei das Mitgefühl als zentraler Einflussfaktor ausgewiesen werden soll, richtet sich in erster Linie an einzelne Menschen.“
Konkreter geht es um die Entwicklung einer „Besonnenheitshaltung (…) in welcher der Antagonismus von Vernunft und Gefühl wenigstens der Tendenz nach überwunden ist, nicht minder der von Individuum und Gemeinschaft.“Als erstes systematisches Ergebnis der Reflexionen ergibt sich die Einsicht: Je moderner, d.h. je multikultureller eine Gesellschaft wird, desto mehr bedarf sie einer Kultivierung der so beschriebenen Form von Besonnenheit. Diese wird zum moralischen Gegengewicht gegen die natürliche „Provinzialität“ des Menschen.
Besonnenheit kultivieren
Im Rahmen einer Auseinandersetzung mit der „Gebrechlichkeit der Vernunft“ entwickelt Bennent-Vahle anschließend eine bestimmte Form von skeptischer Grundhaltung und eine spezifische Konzeption von „Denken der Pluralität“ als Basisstrukturen von Besonnenheit: Diese setzt eine Einsicht in die eigenen Grenzen ebenso voraus wie die Realisierung eines ernsthaften Dialogs mit konkurrieren Meinungen .
Ferner stellt die Autorin emphatisch den notwendigen Zusammenhang von Selbsterkenntnis und Besonnenheit heraus. Ausgehend von Rousseaus markanter Behauptung, „dass einzig Selbsterkenntnis uns zu retten vermag“, entdeckt Bennent-Vahle in kritischer Auseinandersetzung mit dessen Denken neben der natürlichen „Provinzialität“ des Menschen auch dessen ursprüngliche Veranlagung zu „selbstloser Hilfsbereitschaft und sozialer Rücksichtnahme“.
Man kann sagen, dass sich Bennent-Vahles Konzeption von Besonnenheit im Spannungsfeld dieser gegensätzlichen anthropologischen Tendenzen entwickelt. Im weiteren Verlauf ihrer Überlegungen geht es der Autorin hauptsächlich um soziale Tugenden, wobei die Besonnenheit als eine allen diesen Tugenden zugrundeliegende Grundtugend erscheint. Im Zentrum der Überlegungen steht dabei der Zusammenhang von Mitgefühl und Besonnenheit.
Die abschließenden Kapitel sind auf die philosophische Praxis sowie auf die Notwendigkeit einer umfassenden Persönlichkeitsbildung, vor allem auch einer Kultivierung unserer Emotionen hin orientiert. Es geht dabei um die Einübung in die Besonnenheit als eine „neue Bildungsherausforderung“.
Sodann werden ausdrücklich Elemente einer Kultivierung von Besonnenheit im Rahmen der Philosophischen Praxis sowie der schulischen und außerschulischen Bildung angesprochen. Gegen Ende ihrer Ausführungen konkretisiert die Autorin ihre Definition von Besonnenheit:
„Besonnenheit ist das Vermögen, im Abstandnehmen von spontanen Handlungsantrieben gedanklich bei einer Sache zu verweilen, das heißt, die Angelegenheit behutsam von allen Seiten zu betrachten, sie in der Überlegung hin und her zu rücken und dabei die Folgen möglichen Tuns zu überdenken. Entfalten kann sich Besonnenheit besonders gut im kontinuierlichen Austausch mit wohlmeinenden Anderen.“.
Nicht nur thematisch, sondern vielmehr auch in der Darstellungsform wendet sich dieses Buch nicht nur an Fachphilosophen: Die Autorin schreibt ausführlich und gut verständlich; sie schreckt auch vor inhaltlichen Wiederholungen nicht zurück, wenn diese die Verständlichkeit des Textes erhöhen.
Rudolf Lüthe
Heidemarie Bennent-Vahle: Besonnenheit – eine politische Tugend. Zur ethischen Relevanz des Fühlens, Verlag Karl Alber 2020