Ein Interview mit der Psychologin Sandra Konrad
In jeder Familie gibt es Verhaltensweisen, Regeln, Aufgaben und stille Erwartungen, die oftmals von einer Generation auf die andere übergehen. Sie bestimmen manchmal ganze Lebensentwürfe . Die Hamburger Psychologin Sandra Konrad spricht im Interview über dieses stille Erbe, innere Zerrissenheit, Identität und unethisches Verhalten.
„Alles was in einer Generation nicht verarbeitet wurde, hat Auswirkungen auf die Folgegeneration.”
Das Gespräch führte Agnes Polewka
Frau Konrad, welches stille Erbe tragen Sie mit sich herum?
Konrad: Ich hoffe, keins mehr! Mit still meinen Sie wahrscheinlich unbewusst – und dieses unbewusste Erbe kann verheerend sein, denn es macht uns schlimmstenfalls zu Marionetten unserer Familiengeschichte. Wer – wie ich – therapeutisch arbeitet, sollte das eigene Erbe so gut wie möglich aufgedeckt und geklärt haben. Ich habe schon früh damit angefangen, meine Familiengeschichte und was mir dabei mit auf den Weg gegeben wurde, zu sortieren.
Sie schreiben in Ihrem Buch von Erwartungen, sogenannten Aufträgen. Wie häufig kommt es vor, dass solche Erwartungen von einer Generation an die nachfolgende übergeben werden?
Konrad: Alle Eltern haben bewusste und auch unbewusste Erwartungen an ihre Kinder. Das fängt im Grunde schon beim Namen an oder bei der Präferenz für ein Geschlecht. Das ist erst mal nicht pathologisch, sondern völlig normal. Problematisch wird es, wenn die eigenen Vorstellungen enttäuscht werden und es den Eltern nicht gelingt, sich auf das Kind einzustellen.
Was macht das mit dem Kind?
Entweder es versucht alles zu tun, um seine Eltern zufriedenzustellen oder es geht in die Rebellion. Schlimmstenfalls verringern unerfüllbare Aufträge sein Selbstwertgefühl, wenn das Kind spürt, dass es nicht um seiner selbst willen geliebt wird, sondern nur, wenn es die Erwartungen der Eltern erfüllt. Darunter leiden leider viele Menschen und das führt dann natürlich auch zu Problemen in ihren erwachsenen Beziehungen.
Sind Aufträge denn zwangsläufig ein Problem?
Konrad: Nein, solange Aufträge als passend und stimmig erlebt werden, stellen sie kein Problem dar. Wichtig ist, dass Aufträge zurückgewiesen werden dürfen. Nehmen wir den leistungsbezogenen Auftrag „Sei gut in der Schule“ oder „Sei erfolgreich“ – für das eine Kind gar kein Problem, für das andere aber eine Überforderung. Neben den leistungsbezogenen Aufträgen gibt es emotionale Aufträge, da wird es schon schwieriger, zum Beispiel, wenn Kinder sich ihr Leben lang über die Maße um die Eltern kümmern und eigentlich gar kein eigenes Leben aufbauen sollen. Eine absolute Überforderung für jedes Kind!
Woran erkennt man diese stillen Botschaften? Inwiefern wirken sie bis in die Lebensführung des Erwachsenen hinein?
Konrad: Unbewusste Aufträge der Eltern, die nicht passen oder uns überfordern, können dazu führen, dass wir an unserem eigentlichen Lebensglück vorbei leben. Ich gebe mal ein Beispiel: „Mach dich nie von einem Mann abhängig“, war eine der Botschaften, die eine meiner Klientinnen von ihrer Mutter erhielt. Darunter lag auch der unbewusste Auftrag, keine Familie zu gründen, keine eigenen Kinder zu bekommen, damit die Klientin sich auf ihren Beruf – und ihre Mutter – konzentrieren konnte.
Als die Mutter starb, fiel meine Klientin in eine schwere Krise. Sie erkannte irgendwann, dass sie nicht nur um ihre Mutter trauerte, sondern auch darum, dass sie selbst nie Mutter geworden war, dass sie blind einem Auftrag gefolgt war, den sie erst hinterfragen konnte, als die Mutter gestorben war.
Sich von familiären Regeln verabschieden
Wir schafft man es, im Widerhall der elterlichen Aufträge die eigene Stimme zu hören?
Konrad: Das ist eine große Herausforderung, denn im Laufe der Zeit fühlen sich die elterlichen Stimmen oft wie eigene an. Gerade in Familien, die viel Loyalität einfordern, ist es wirklich schwer, das auseinanderzudividieren.
Aber es ist für uns alle eine existentielle Entwicklungsaufgabe – herauszufinden, was unsere eigenen Bedürfnisse sind. Was uns ruhig und zufrieden macht. Wie wir leben wollen. Und das ist auch der Weg zur eigenen Stimme – zu fühlen, was uns gut tut und uns dann von familiären Regeln oder Stimmen Schritt zu Schritt zu verabschieden.
Hallen nur die Stimmen der Eltern in unseren Köpfen nach oder reicht das stille Erbe noch tiefer zurück in unsere eigene Familiengeschichte?
Konrad: Je weniger die Eltern sich von familiären Gesetzen, ungesunden Loyalitäten und unpassenden Aufträgen gelöst haben, desto eher werden sie auch in uns noch wirken. Deshalb ist es ja so wichtig, dass jede und jeder Einzelne versucht, so gut wie möglich auszumisten.
Häufig gibt es aber auch Lebensthemen unserer Vorfahren, die im eigenen Leben auftauchen. Diese auf den ersten Blick unerklärlichen Wiederholungen machen aber – wenn man sich die gesamte Familie anschaut – plötzlich Sinn. Es geht da zum Beispiel um das ungelebte Leben der Eltern, um unerledigte Geschäfte der Großeltern, um familiäre Träume oder um Enttäuschungen. Man spricht hier von transgenerationalen Weitergaben. Besonders Traumata wirken stark in Familien weiter.
Das Problem von Familiengeheimnissen
Wie kann es denn sein, dass ungelöste Lebensthemen anderer Menschen so maßgeblich auf die eigene Persönlichkeit einwirken?
Konrad: Alles, was in einer Generation nicht verarbeitet wurde, hat Auswirkungen auf die Folgegeneration. Oft sind es traumatische Erfahrungen wie Gewalt, Krieg, Flucht, schwere Ungerechtigkeiten oder unabgeschlossene Trauerprozesse. Diese Traumata werden dann transgenerational in der Familie weitergegeben: über die Gene, über Bindung, über das elterliche Verhalten, über erzählte und spannenderweise auch über nicht-erzählte Geschichten.
Das heißt, dass selbst Geheimnisse eine Wirkung haben, sie nehmen oft sogar großen Raum im Familiengefüge ein und dann kann es sein, dass das Geheimnis in der Enkelgeneration aufgedeckt wird. Geheimnisse haben eine hohe unbewusste Anziehungskraft und können das Lebensgefühl der Nachkommen extrem beeinflussen.
Führen stille Familienaufträge zu unethischem Verhalten?
Konrad: Das ist eine schwierige Frage, denn wenn jemand etwas unbewusst verlangt oder den anderen unbeabsichtigt verletzt, fehlt ja die schädigende Intention. Außerdem führt nicht jeder unbewusste Auftrag zu Schwierigkeiten. Idealerweise übernehmen wir möglichst viel Verantwortung für unser eigenes Leben.
Je bewusster wir uns über unsere Familiendynamik und unsere Rolle sind, je mehr wir unsere Aufträge und unsere Glaubenssätze erkannt und hinterfragt haben, je mehr wir versuchen, unseren eigenen Lebensschmerz zu lindern, desto weniger Ballast geben wir an unsere Kinder weiter. Das wäre ethisch und sehr gesund.
Sollten wir unser familiäres Erbe besser annehmen oder ausschlagen?
Konrad: Das, was passt und uns nährt, sollten wir natürlich nutzen und genießen. Und das, was uns das Leben schwer macht, was uns blockiert, uns runterzieht, das sollten wir unbedingt ausschlagen. Niemand wird geboren, um die Erwartungen der Eltern zu erfüllen.
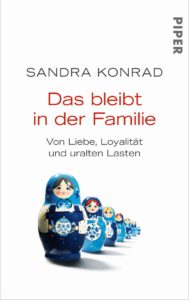 Sandra Konrad ist Diplom-Psychologin und hat an der Universität Hamburg Psychologie, Sexualwissenschaften, Psychiatrie und Germanistik studiert. In ihrer Doktorarbeit beschäftigte sie sich mit mehrgenerationale familiären Weitergaben, insbesondere in Bezug auf Traumata. Seit 2001 arbeitet Sandra Konrad als systemische Einzel-, Paar- und Familientherapeutin in ihrer eigenen Praxis in Hamburg. Konrad hat mehrere Bücher geschrieben, ihre Themenschwerpunkte liegen auf zwischenmenschlichen Beziehungen, Sexualität und transgenerationalen Weitergaben und ihrem starken Einfluss auf die Gegenwart. Konrad ist verheiratet und lebt in Hamburg. Sie hat Bücher veröffentlicht, u.a. Das bleibt in der Familie, Piper Verlag 2013
Sandra Konrad ist Diplom-Psychologin und hat an der Universität Hamburg Psychologie, Sexualwissenschaften, Psychiatrie und Germanistik studiert. In ihrer Doktorarbeit beschäftigte sie sich mit mehrgenerationale familiären Weitergaben, insbesondere in Bezug auf Traumata. Seit 2001 arbeitet Sandra Konrad als systemische Einzel-, Paar- und Familientherapeutin in ihrer eigenen Praxis in Hamburg. Konrad hat mehrere Bücher geschrieben, ihre Themenschwerpunkte liegen auf zwischenmenschlichen Beziehungen, Sexualität und transgenerationalen Weitergaben und ihrem starken Einfluss auf die Gegenwart. Konrad ist verheiratet und lebt in Hamburg. Sie hat Bücher veröffentlicht, u.a. Das bleibt in der Familie, Piper Verlag 2013







