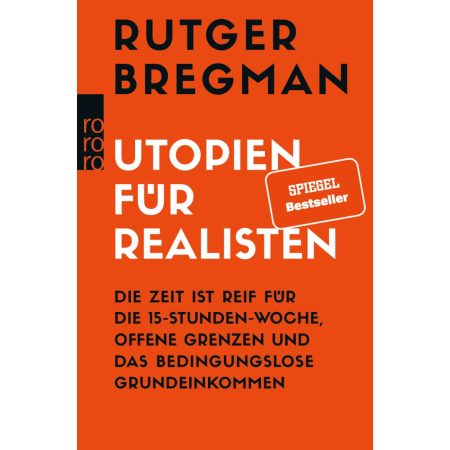Ein Buch über Utopien und wie sie wirklich werden können
Der Historiker Rutger Bregman will die Welt verändern. Das Problem ist nicht, dass das nicht geht, sondern dass wir zu wenig Fantasie und Mut haben, es zu tun. An drei großen Beispielen skizziert er, wie es möglich ist: das bedingungslose Grundeinkommen, offene Grenzen und die 15-Stunden-Woche.
„Das größte Problem der Underdog-Sozialisten ist nicht, dass sie im Irrtum sind. Ihr größtes Problem ist, dass sie langweilig sind“, ist eine der knackigen Aussagen des Historikers und Journalisten Rutger Bregman. „Underdog-Sozialisten“ sind für ihn die Linken, die sich lediglich im politischen und ökonomischen Rahmen des liberalen Mainstream bewegen und darin die Position der Armen, Benachteiligten und Ausgegrenzten einnehmen. Bregman ist viel radikaler. Linke Politik, so die Botschaft seines Buches, müsse aus dem gegebenen Rahmen ausbrechen und Utopien entwerfen. Denn mit den Mitteln der gängigen Politik ließen sich die Probleme nicht lösen.
Schauen wir, welche Alternativen der Historiker zu bieten hat und welche Utopien er dagegen setzt – und zwar in drei Feldern: das bedingungslose Grundeinkommen, offene Grenzen und die 15-Stunden-Woche.
Armutsbekämpfung: Es reiche nicht, Sozialprogramme aufzustocken, da sie selbst Teil des Systems der Armutserhaltung seien. Besser als alle Programme zur Unterstützung von Armen sei es, ihnen einfach Geld zu geben, etwa in Form eines bedingungslosen Grundeinkommens.
Anhand einiger interessanter und wissenschaftlich gut belegter Beispiele berechnet der Autor, dass die Kosten für die Ausbildungs- und Umschulungsprogramme für Arbeitslose, Prüfung der Bedürftigkeit von Sozialhilfeempfängern, Wohnungsvermittlungen für Obdachlose usw. die Summe dessen übersteigt, was bei den Bedürftigen tatsächlich ankommt.
Würde man hingegen den Armen einfach Geld geben, gingen sie damit in den allermeisten Fällen sehr sorgsam um und veränderten ihr Leben in kurzer Zeit so, dass sie auf die Unterstützung nicht mehr angewiesen sind. Sozial Benachteiligte wüssten sehr viel besser als ihre Sozialarbeiter, was das Beste für sie ist. „Die Ursache der Armut ist der Mangel an Geld“, wird ein bekannter Ökonom zitiert.
Offene Grenzen und weniger arbeiten
Offene Grenzen: Ein gut ausgebildeter Arbeitsloser will seine Arbeitskraft dem Markt zur Verfügung stellen. Es gibt nur ein „Problem“: Der Mann ist Flüchtling, ihm wird der Zugang verwehrt. Bregmanns zweite Forderung ist die Abschaffung von Grenzen.
Und auch in diesem Teil des Buches gibt er viele solide Belege dafür, wie der Wohlstand der Welt steigen würde, wenn alle Menschen Zugang zu allen Arbeitsplätzen der Welt hätten. Die Zahlen, die er anbringt, zeigen, dass das Bruttoglobalprodukt um bis zu 147 Prozent steigen würde, laut dem Harvard Ökonom Lant Pritchet um 65 Billionen Dollar, wenn die Grenzen offnen wären.
Der Autor ist überzeugt, dass die Entwicklungshilfe, die von den westlichen Industrienationen in die armen Regionen fließt, immerhin fast 135 Milliarden Dollar jährlich, wenig bewirken. Die Gründe seien einerseits, dass auch hier ein großer Teil des Geldes für die Verwaltung aufgewendet wird, andererseits, dass häufig planlos und an den falschen Stellen „geholfen“ würde. Im Übrigen schätzt die OECD, dass arme Länder durch Steuerhinterziehung dreimal so viel Geld verlieren, wie sie durch Entwicklungshilfe erhalten. Die Schließung der Steueroasen könnte hier weit mehr bewirken als jede Entwicklungshilfe.
15-Stunden-Woche: Wachsende Effektivität hat vielen Ländern einen nie gekannten Wohlstand gebracht. Die Produktivität in Landwirtschaft und Industrie sind in den letzten 100 Jahren rasant gestiegen, so dass heute ein Bruchteil der Bauern und Industriearbeiter ein Vielfaches dessen herstellen können, was früher möglich war. Die Folge müsste nach den Regeln der Marktwirtschaft eigentlich sein, dass sie auch ein Vielfaches verdienen oder nur noch einen Bruchteil arbeiten müssen. Dem ist aber nicht so. Wo ist dann der Ertrag der steigenden Effizienz geblieben?
Bregmann unterscheidet zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit und hat herausgefunden, dass der Effizienzgewinn in unproduktive Arbeit fließe. Ein Heer von Börsenmaklern, Rechtsanwälten, Telefonverkäufern, Social Media-Strategen und Werbeagenten, also Menschen, die keinen Wohlstand schaffen, sondern nur Wohlstand hin und her schieben, verbräuchten die Gewinne. Darauf könne die Gesellschaft aus seiner Sicht leicht verzichten.
Wofür es sich zu kämpfen lohnt
Bregmanns Utopien zeigen, wovon viele Menschen träumen. Grundeinkommen, offene Grenzen und 15 Stunden Wochenarbeitszeit – das wäre etwas, wofür sich zu kämpfen lohnt. Am überzeugendsten ist die radikale Arbeitszeitverkürzung, mit der die meisten sozialen Probleme der industrialisierten Länder gelöst werden könnten. Es wäre die naheliegendste Konsequenz, die aus dem enormen Effizienzgewinn, den Industrie und Maschinen geschaffen haben, gezogen werden kann.
Die andere Möglichkeit, diesen Gewinn auf alle zu verteilen, das bedingungslose Grundeinkommen, überzeugt schon weniger. Denn es ist schwer einzusehen, dass auch reiche Menschen es erhalten sollen.
Offene Grenzen erscheinen erst dann machbar, wenn die industrialisierten Länder auf die systematische Verarmungsstrategie, die sie gegenüber anderen Erdteilen verfolgen, verzichten. Die Länder des Südens werden ganz selbständig zu Wohlstand und Stabilität finden – wenn wir sie nur lassen. Dann würden auch die meisten Gründe entfallen, die zu Migration führen.
Der umgekehrte Ansatz der ausgleichenden Gerechtigkeit, alle Menschen in die reichen Länder einwandern zu lassen, weil die Reichen ihren Wohlstand den armen Ländern verdanken, ist eine imperialistische Idee – hier mit menschlichem Antlitz. Dahinter steht der Gedanke, die Probleme der Welt könnten durch die reichen Länder und in ihnen gelöst werden.
Mit seinem radikalen, klugen und hervorragend recherchierten Buch zeigt Bregmann, wie gut unsere Zukunft sein könnte, wenn wir aus unseren Denkgefängnissen ausbrächen.
Carsten Petersen
Rutger Bregmann. Utopien für Realisten: Die Zeit ist reif für die 15-Stunden-Woche, offene Grenzen und das bedingungslose Grundeinkommen. Rowohlt Taschenbuchverlag 2019