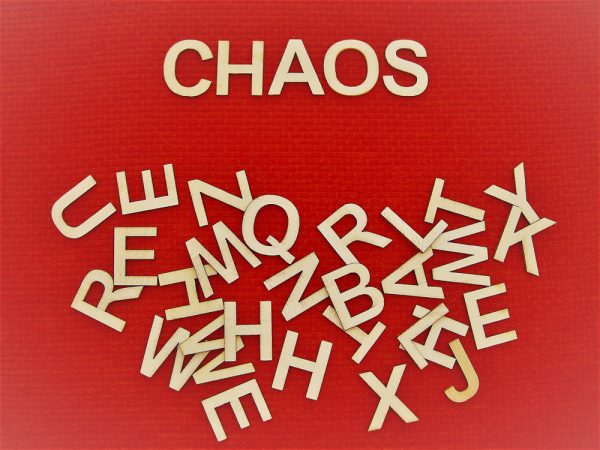Ein Standpunkt von Sabine Breit
„Framing“, ein Begriff, der u.a. in der Linguistik verwandt wird, hält Einzug in Politik und Zivilgesellschaft. Die Linguistin Sabine Breit kritisiert, dass Framing benutzt wird, um zu manipulieren. Sie fordert, dass Sprache als Medium für echten Dialog eingesetzt wird statt zur Manipulation.
„Framing“ ist gerade in aller Munde. Ein Begriff, der in mehreren wissenschaftlichen Disziplinen auf unterschiedliche Art verwendet wird und immer etwas schwammig bleibt. In der Essenz geht es darum, dass ein Wort nie nur eine informative Abfolge von Buchstaben ist, sondern gleichzeitig alle möglichen Emotionen und letztlich Bewertungen transportiert, die unser Handeln sowie das Handeln anderer in entscheidender Weise beeinflussen. Darum, dass Menschen nun mal so reden, wie sie denken und so denken, wie sie reden und auch zumeist nur das hören, was sie wollen oder verstehen können. Ob wir das Frame nennen oder anders, spielt keine Rolle. Das Wissen um diese Zusammenhänge kann uns allerdings helfen, uns und andere besser zu verstehen.
Problematisch wird es allerdings, wenn dieses Wissen dazu benutzt wird, künstlich manipulative „Frames“ zu schaffen und Sprache damit missbraucht wird. Egal von wem. Wenn Sprache nicht als Medium für einen wahrhaftigen Dialog verstanden wird, sondern als Mittel zum Zweck, als „Munition“ oder Waffe zum Erreichen von Partikularzielen im Rahmen eines anachronistischen Weltbilds, sozusagen eines „Über-Frames“, von Gut und Böse, Freund und Feind.
Statt sich gegenseitig die potemkinschen Sprachdörfer der künstlichen„Frames“ und „Gegen-Frames“ um die Ohren zu hauen, ist es viel ergiebiger hinter diese „Denkrahmen“ zu schauen. Damit aus einer Debatte ein Dialog werden kann.
Das ganze Bild sehen, statt nur den Rahmen
Ein Beispiel für einen Frame, der zu einem Dialog hätte führen können, war erst kürzlich bei der Münchner Sicherheitskonferenz zu beobachten. Nach ihrer Rede stand Angela Merkel noch für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung. In einer ihrer Antworten warf sie die Demonstrationen unserer Kinder, die gerade überall Freitags auf die Straße gehen, um für ihr Leben auf diesem Planeten zu kämpfen, mit der hybriden Kriegsführung durch russische Trolle und den Bemühungen von Steve Bannon in einen Topf. Wörtlich sagte sie:
„Deutschland hat Gegner. Die hybride Kriegsführung seitens Russlands ist täglich zu spüren. (….). Diese hybride Kriegsführung im Internet ist sehr schwer zu erkennen, weil sie plötzlich Bewegungen haben, von denen sie gedacht haben, dass die nie auftreten – die immer ansetzen an einem Manko.
In Deutschland protestieren jetzt die Kinder für Klimaschutz. Das ist ein wirklich wichtiges Anliegen. Aber dass plötzlich alle deutschen Kinder – nach Jahren ohne jeden äußeren Einfluss – auf die Idee kommen, dass man diesen Protest machen muss, das kann man sich auch nicht vorstellen. Also Kampagnen können heute übers Internet viel leichter gemacht werden (…) Und wir haben auch andere Gruppen, ich will da durchaus Steve Bannon nennen. (…)“ (1)
Der „Frame“ erstreckt sich von Russland und der hybriden Kriegsführung über das Internet, zu den Protesten unserer Kinder bis zu Steve Bannon in den USA. Ein dicker Hund! Fixiert auf den Rahmen kann man nun die Gelegenheit zur Vorverurteilung nutzen und mit Wucht zum Gegen-Frame ausholen. Oder man kann tief durchatmen, einen Schritt zurücktreten und die Möglichkeit ergreifen, mit einem fragenden Geist zu versuchen, das gesamte Bild zu durchdringen und den Menschen hinter dem Frame zu ergründen.
Über die eigenen Denkmuster reflektieren
Weiten wir also den Blick und schauen uns die Sprechsituation an. Angela Merkel hat nicht von einem vorbereiteten Manuskript abgelesen, sie hat frei gesprochen. So könnte man sich fragen, ob wir es hier nicht mit einem Fenster in die Denkmuster, die Persönlichkeit und die gegenwärtige Verfasstheit von Angela Merkel zu tun haben, statt mit einem Propagandarahmen. Zeugt ihre Ausdrucksweise tatsächlich von Bösartigkeit, oder vielleicht eher von einem Unverständnis für die gegenwärtigen Entwicklungen? Einem „Nicht-Begreifen-Können“, was da gerade vor sich geht und dem Versuch, das Unbegreifliche in bekannte und greifbare Muster (Internet = hybride Kriegsführung) einzuordnen. So wie wir das im Übrigen alle mit Neuem machen. Oder hat sie sich einfach nur versprochen?
Säße man ihr gegenüber, könnte man das ansprechen. Man könnte etwa fragen: „Frau Merkel, Sie haben eben unsere protestierenden Kinder in einem Atemzug genannt mit Vladimir Putin und Steve Bannon. Meinen Sie das wirklich so? Ist das ihre Überzeugung?“ Sollte ihr nicht bewusst gewesen sein, was sie da wie gesagt hat, kann ihr eine solche Frage diese Wirklichkeit ins Bewusstsein bringen. Sie bekommt die Chance, dies selbst zu reflektieren. Wie sie dann damit umgeht und darauf antwortet, ist ihre Sache und kann Anlass für weitere Fragen bieten. Auf diese Weise können sich Schritt für Schritt Gespräche mit großer Tiefe und Ehrlichkeit ergeben, in denen alle Beteiligten die Chance bekommen, über die eigenen, teilweise unbewussten, Denkmuster zu reflektieren und eventuell „umzudenken“.
Herzenssprache statt Manipulation
Wir brauchen kein linguistisches Fachwissen, um uns auf einen wahrhaftigen Dialog einzulassen. Eigentlich braucht es vor allem Aufmerksamkeit, Offenheit und Mut. Aufmerksames, genaues und unvoreingenommenes Zuhören, und zwar den Worten anderer ebenso wie den eigenen, während sie aus dem Mund purzeln. Die Bereitschaft, unserem Gegenüber nicht reflexartig sofort etwas Böses zu unterstellen, wenn wir glauben, einen „bösen Frame“ erkannt zu haben. Aber eben auch die Fähigkeit und den Mut, klar und hartnäckig nachzufragen, wenn wir etwas nicht hinnehmbar finden. Die Fähigkeit und den Mut, unsere Positionen, die wir im Herzen und im Hirn tragen, klar – und gerne auch leidenschaftlich – zu formulieren. Und einen bewussten, liebevollen Umgang mit Sprache.
Jeder von uns ist selbst verantwortlich dafür, sich diese Aufmerksamkeit, diese Offenheit und diesen Mut zu erarbeiten. Das macht ein bisschen Mühe und dauert eine Weile, aber die Mühe wird reich belohnt. Denn je bewusster wir werden, umso klarer und leichter werden die Dinge. Und umso klarer und kraftvoller wird auch unsere Sprache.
Ich erlebe immer häufiger, wie ich selbst und viele Menschen um mich herum, zunehmend langsamer reden. Während des Sprechens nach Worten suchen, sie verwerfen, weil es nicht zu passen scheint, Pausen machen, neu ansetzen. Sich während des Redens bewusst werden, was für einen Quatsch sie eigentlich gerade sagen wollten und mittendrin einen Salto rückwärts machen. Und in diesem Prozess zu ihrer Herzenssprache finden. Zu den Wörtern, die genau das ausdrücken, was eigentlich aus ihnen heraus will. Was in aller Klarheit gesagt werden will und muss. Anstelle von Wörtern, mit denen man einen cleveren „Frame“ baut, um sich selbst und andere hinters Licht zu führen. Künstlich „framen“ muss man nur, wenn das Herz nichts zu sagen hat.
Sabine Breit
(1) Link zu der Rede von Angela Merkel auf der Münchner Sicherheitskonferenz: https://www.youtube.com/watch?v=77ldCeytas0. Die zitierte Passage beginnt ab ca. Minute 40:30

Sabine Breit hat angewandte Sprachwissenschaft studiert und ist seit über 20 Jahren als Linguistin in die Unternehmenskommunikation sowohl mittelständischer Unternehmen als auch internationaler Großkonzerne eingebunden. Sie ist u.a. Mitgründerin von LogosLogos. Sabine hat eine bezaubernde Tochter, eine sehr kommunikative Katze und findet Ausgleich vom Kommunizieren im Reisen, beim Lesen, beim Sport und in der Meditation.