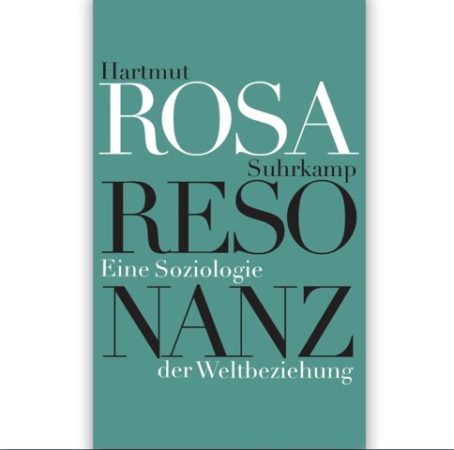Das neue Buch von Hartmut Rosa
In der beschleunigten Gesellschaft geht es um das Vermehren von Ressourcen. In seinem Buch „Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung“ schlägt Rosa ein neues Weltverhältnis vor: die Resonanz, also dass wir uns von dem, was uns begegnet berühren lassen. Ursula Baatz stellt das Buch vor.
Professor Hartmut Rosa spricht auf Einladung von Netzwerk Ethik heute und Numata-Zentrum für Buddhismuskunde der Universität Hamburg am 27. Oktober 2016 zum Thema “Achtsamkeit und Selbstbezogenheit – eine Kritik aus gesellschaftspolitischer Sicht.”
Zwei junge Künstler nehmen an einem Wettbewerb teil, beide sind begabte Maler. Der eine kauft alles, was er fürs Malen braucht: Staffelei, Pinsel, Farben, Leinwand, Grundierung. In seinem Atelier baut er alles auf, setzt sich vor die leere Leinwand und beginnt nach einem Thema für das Bild zu suchen. Der andere Jungmaler reißt ein Blatt vom Malerblock, holt die Wasserfarben, und beginnt zu malen, zunächst ohne klaren Plan, bringt er allmählich eine Welt aus Farben und Formen aufs Blatt.
Der eine ist ressourcenfixiert, der andere überlässt sich seiner Kreativität. Wer wird den Wettbewerb gewinnen? Die Antwort scheint offensichtlich, und man freut sich über den kreativen Schwung. Die Industriegesellschaft als Ganzes funktioniert ressourcenfixiert; für Kreativität und Sich-öffnen sei wenig Platz, meint der Soziologe und Politikwissenschaftler Hartmut Rosa.
Rosa ist seit langem als kritischer Analytiker der beschleunigten Gesellschaft bekannt. Das Ergebnis des beschleunigten Lebens lässt zu wünschen übrig – mit Ödön von Horvath seufzen wohl viele: „Eigentlich bin ich ganz anders, nur komm ich so selten dazu“. Vermehrung von Ressourcen – das neue Auto, das größere Haus, die Gehaltserhöhung – machen nicht glücklich. Aber was macht dann Gutes Leben aus? Dieser Frage geht Rosa in seinem neuen Buch „Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung“ nach.
Resonanz nicht greifbar, aber hat Folgen. Wenn eine große Menschenmenge im Gleichschritt über eine Brücke marschiert, kann es sein, dass die Brücke einstürzt, ohne dass jemand auch nur einen Finger rührt. Die Schritte der Marschierenden erzeugen Schwingungen in der Brücke, es entsteht Resonanz, die die Schwingungen verstärkt. Das kann dazu führen, dass die Brücke einstürzt. Bekommt der Korpus einer Geige oder Gitarre einen Sprung, ist das Instrument kaputt, auch wenn alles andere intakt ist – weil der Resonanzraum gestört ist.
Resonanz ist ein Weltverhältnis
Resonanz ist ein Begriff aus der Physik, aber auch aus der Musik, der als Metapher für soziale Verhältnisse verwendet wird. Von Resonanz spricht man, wenn Menschen wortlos miteinander im Gleichklang sind, oder auch, wenn jemand mit sich selbst und der Welt in Übereinstimmung ist. Resonanzbeziehungen sind beglückend, aber brauchen, was in einer beschleunigten Gesellschaft rar ist, nämlich Zeit – Zeit, sich auf die Welt einzulassen.
Dies ist Rosas erstes Ergebnis: Beschleunigung verhindert, sich auf die Welt einzulassen. Zudem sind Resonanzerfahrungen – z.B. mit Musik oder Filmen – momenthaft und unverfügbar, erzeugt doch die Lieblingsmusik oder der Lieblingsfilm nicht immer gute Stimmung. Resonanz ist kein Gefühl, kein Gedanke und auch keine „feinstoffliche“ Substanz, sondern ein Weltverhältnis. Es liegt weder an einem Beruf noch an einer bestimmten Tätigkeit, ob ein Mensch sich in Resonanz mit der Welt wahrnimmt.
Resonanz ist eine Relation, schreibt Rosa – und das ist ganz konkret gemeint. Es geht um Offenheit der Welt und sich selbst gegenüber, und zwar so, dass die Welt nicht als Gegenstand der Manipulation erfahren wird, sondern als etwas, das einen berührt und verwandelt. In einer auf Ressourcen fixierten Welt sind solche Erfahrungen selten. Vielleicht, so meint Rosa, ist dies auch der Grund, warum sich viele für außereuropäische Kulturen interessieren und Urlaube in Asien oder Afrika als besonders erholsam erleben. Es sind Gesellschaften, in denen Resonanzbeziehungen wichtiger als Ding-Beziehungen sind.
Der Begriff „Resonanz“ hat für Hartmut Rosa gesellschaftskritisches Potential, denn in der beschleunigten Gesellschaft schwindet die Fähigkeit zur Resonanz – und damit die Fähigkeit zur Empathie. Das ist weder sentimental noch emotional gemeint, sondern hat handfeste Folgen. Verlust der Resonanzfähigkeit führt zum Beispiel zu Depression und Burn-out.
Zulassen, dass Beziehungen uns verändern
Von diesen „Volkskrankheiten“ Betroffene erleben die Welt als kalt und leer, nichts vermag sie mehr zu berühren – und zugleich verlieren sie selbst die Fähigkeit, sich auf Welt und Menschen zuzubewegen. Der Verlust der Resonanz bedeutet Entfremdung. Entfremdung ist eine „Beziehung der Beziehungslosigkeit“ (Rahel Jaeggi), und die entsteht durch gesellschaftliche Bedingungen. Nach einer US-amerikanischen Untersuchung hat sich die durchschnittliche Fähigkeit zur Empathie bei College-Studenten zwischen 1979 und 2009 um 40 Prozent verringert. Ursachen dafür: der zunehmende Zwang zum Wettbewerb, die gesellschaftliche Beschleunigung sowie längere Verweildauer vor Bildschirmen.
Rosa geht es um eine genaue Beschreibung der Bedingungen, unter denen ein geglücktes Verhältnis zur Welt zustande kommen kann. Dazu gehört die neuronale Verankerung. Dass wir lächeln, wenn jemand anderer lächeln, oder dass Gähnen ansteckend ist, liegt an den Spiegelneuronen, deren „Feuern“ der physiologische Aspekt der Resonanz ist.
Der aktive Teil der Resonanz ist die Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Resonanzblockaden entstehen dort, wo die Erwartung der Selbstwirksamkeit untergraben wird – wenn etwa ein Lehrer sagt: „das kannst du eh nicht“. „Die leuchtenden Augen eines Menschen“ sind Indiz für die gelungene Resonanzbeziehung. Dass das kreative Potential von Resonanz ausgebeutet und entfremdet wird, verschweigt Rosa nicht. Eine Kritik der gesellschaftlichen Resonanzfähigkeit scheint deswegen umso dringlicher.
Mehr als Wissensvermittlung: die Resonanzpädagogik
Hartmut Rosa ist nicht nur Professor für Soziologie an der Universität Jena, Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt und Mit-Herausgeber der Fachzeitschrift Time & Society, sondern auch seit vielen Jahren Akademieleiter der Deutschen SchülerAkademien. Lehrer sein ist ihm wichtig – es heißt, Menschen zu helfen, sich die Welt durch Resonanz anzuverwandeln. Das ist viel mehr als Kompetenz-Erwerb.
Erst durch Resonanz kann wirkliches Wissen entstehen, betont Rosa. Sich auf eine Resonanzbeziehung einlassen bedeutet „offen dafür zu sein, dass mir etwas Neues begegnet, wovon ich berührt, ergriffen oder bewegt werde, also zuzulassen, dadurch verändert zu werden.“ So steht es in dem schmalen, aber gewichtigen Band „Resonanzpädagogik“, in dem der Pädagoge Wolfgang Endres ein Gespräch mit Rosa aufgezeichnet hat.
„Wenn es dem Lehrer gelingt, die Aufmerksamkeit seiner Schüler so zu fesseln, dass es im Klassenzimmer `knistert`, entstehen Momente des wechselseitigen geistigen Berührens und Berührtwerdens.“ Resonanzpädagogik ist keine Kuschelpädagogik, sagt Rosa. „Knistern“ kann es auch, wenn es einen Konflikt im Klassenzimmer gibt oder Meinungsverschiedenheiten, aus denen sich eine Diskussion entwickelt.
Überhaupt will Rosa keine Romantik aufkommen lassen – auch wenn das Konzept der „Resonanz“ dazu verleiten könnte. Es ist ein politisches Konzept: gegen das „Verstummen der Welt“ muss individuell und gemeinsam dagegen gehalten werden. „Eine bessere Welt ist möglich… ihr zentraler Maßstab ist nicht mehr das Beherrschen und Verfügen, sondern das Hören und Antworten“, betont Rosa.
Ursula Baatz
Mit freundlicher Genehmigung der österreichischen Wochenzeitung “Die Furche”, wo der Artikel a
m 21. Juli 2016 erschienen ist.
Hartmut Rosa, Resonanz: Eine Soziologie der Weltbeziehung. Berlin 2016, 816 Seiten