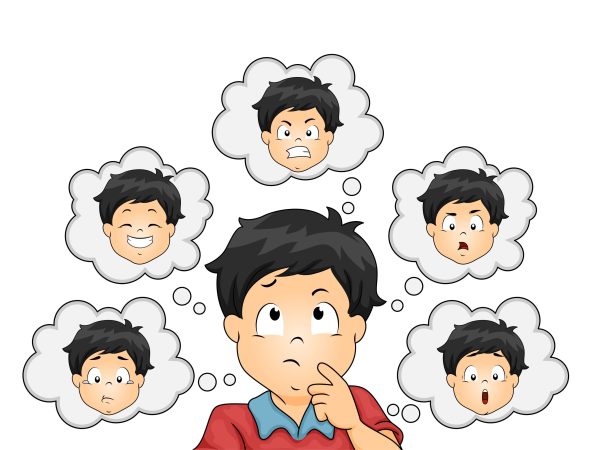Inneren Konflikten auf den Grund gehen
Etwas darf nicht passieren, etwas muss unbedingt geschehen – wir sind blockiert. Introvision ist eine Methode zur mentalen Selbstregulation. Innere Konflikte werden in mehreren Schritten auf der Basis achtsamer Wahrnehmung bearbeitet. Dadurch löst sich die Anspannung und es eröffnen sich neue Handlungsoptionen.
Etwas darf nicht passieren – die Ablehnung durch eine geschätzte Person – oder etwas muss unbedingt geschehen – ein Problem muss gelöst werden: Diese beiden Überzeugungen kennzeichnen sogenannte subjektive Imperative, also Glaubenssätze, die unser Handeln leiten. Sie werden auch „Muss-Darf-nicht-Syndrom“ genannt und sind verbunden mit einem Gefühl der Dringlichkeit und des Selbstalarms. In anderen Kontexten spricht man von inneren Antreibern, Mitgliedern eines inneren Teams oder – sprachlich zugespitzt – von Mindfucks.
Ich muss gut sein! Ich darf nicht versagen! Ich will geliebt werden! Erleben wir Situationen im Alltag, die unseren Sollvorstellungen entgegenstehen könnten, wenden wir unterschiedliche, quasi gezielt ausgearbeitete, vielfach automatisch ablaufende Strategien an, um einen bestimmten Soll-Zustand aufrecht zu erhalten.
Sind Ist- und Soll-Zustand im Ungleichgewicht, steigt die Anspannung. Unsere Sprache signalisiert dabei deutlich die darin enthaltende Willenskraft, eine Art von Anstrengung, die sich auch körperlich ausdrücken kann. Introvision ist ein Verfahren, innere Konflikte und Probleme zu bearbeiten, die sich nicht dauerhaft wegschieben lassen, die wiederkehren, oft mit zunehmender Vehemenz und zu unangemessenem Verhalten führen können.
Wie entstehen innere Konflikte?
Prof. Dr. Telse Iwers führte bereits in 2001 den Begriff Introvision ein und bringt die Essenz der Methode auf den Punkt: Innenschau. Es ist der Blick auf die inneren, mentalen Prozesse, die Art der Wahrnehmung, die den Menschen im Kern, in seinem Fühlen, Denken und Handeln ausmachen.
„Ich hätte niemals geglaubt, dass ich einfach nur aus Angst vor der Ablehnung nicht mehr ausgehe.“ Es sind diese Aha-Effekte, die beobachtet werden können, wenn Menschen zum ersten Mal mit Introvision in Berührung kommen. Ist die Neugier erst einmal geweckt, möchte man wissen, welche inneren Prozesse da eigentlich ablaufen, die Abläufe im Alltag blockieren.
Woran liegt es, dass Menschen unter ihren Möglichkeiten bleiben, Chancen verstreichen lassen, Konflikte nicht lösen können oder im Ernstfall vor Erschöpfung körperlich oder seelisch erkranken? Hierzu liegen umfassende Grundlagen aus der Introvisionsforschung vor, theoretisch begründet, empirisch erforscht und vielfach praktisch erprobt.
Die Situation der Lehrenden und Lernenden sowie die Optimierung von Unterrichtsstrategien waren vor vierzig Jahren Anlass für eine Untersuchung an der Universität Hamburg, aus der später die Introvision hervorgegangen ist. Prof. Dr. Angelika C. Wagner stellte sich damals mit ihrem Forschungsteam zwei Fragen: Erstens: Wie entstehen bestimmte Konflikte? Zweitens: Wie kann man diese Konflikte auflösen?
Über 60 Studien liegen im Rahmen des Langzeitforschungsprogramms inzwischen zur Wirkweise der Introvision vor. Zwei zentrale Theorien sind in dieser Zeit entstanden: die Theorie der mentalen Introferenz (TMI), die sich mit der Informationsverarbeitung des Menschen auseinandersetzt, sowie die Theorie der subjektiven Imperative (TSI), in deren Rahmen subjektive Imperative analysiert werden, die inneren Konflikten zugrunde liegen.
Somit steht die Introvision heute auf einer breiten wissenschaftlichen und theoretischen Basis. Ihre Wurzeln liegen im universitären Umfeld, doch die Methode ist praxis- und lebensnah. Die Introvision wurde und wird noch in unterschiedlichen Anwendungsfeldern untersucht, insbesondere in Bereichen der Gesundheitsförderung (Nackenverspannungen, Migräne oder Tinnitus) und der Stressreduktion.
Schritt für Schritt zum Kernkonflikt
Der eigentliche Prozess der Innenschau basiert auf dem Konstatierenden Aufmerksamen Wahrnehmen, des KAW, das in einem speziell dafür entwickelten Übungsprogramm gelernt wird. In vier Schritten wird die Wahrnehmung zunächst beim Sehen, Hören und Spüren geübt. Die Kompetenz ausdifferenzierter Wahrnehmungsfähigkeit ist die Basis für Introvisionsberatung und -coaching.
Im Prozess der Introvision wird erarbeitet, was der Kern des Problems ist. Dabei werden Schicht für Schicht Bewusstseinsinhalte, Gedanken, Gefühle konstatierend betrachtet und entsprechend formuliert.
Die Aussage „Dann werde ich mich fürchterlich blamieren“, imperativisch aufgeladen und mit Erregung verknüpft, heißt zum Beispiel konstatierend: „Es kann sein, dass ich mich blamiere.“ In der Regel wird eine Abfolge mehrerer, zusammenhängender Glaubenssätze aufgedeckt, bis man zum Kernimperativ kommt, der in diesem Beispiel so lauten könnte: “Dann versage ich!” (Das darf auf gar keinen Fall sein!).
Die dazugehörende Subkognition lautet: „Es kann sein, dass ich versage“. Dieser Satz wird eine Weile konstatierend angesehen. So ist es also, aha. Dieser Kern wird angenommen, nicht mehr verdrängt, Gelassenheit kehrt ein.
Selbststeuerung auf der Basis von Achtsamkeit
Konflikte meistern, innere Blockaden abbauen und an wiederkehrenden Verhaltensmustern arbeiten, kann man lernen. Ein funktionierendes Selbstmanagement auf Basis einer wertschätzenden, achtsamen Grundhaltung ist die Grundlage, um dauerhaft Stress abzubauen. Es steigert das Wohlbefinden, macht zufrieden und wieder handlungsfähig – und zwar mit nachhaltiger Wirkung.
Introvision ist eine wirksame Methode zur Mobilisierung der eigenen Kräfte und Förderung des Selbstmanagements in solchen Situationen. Sie basiert, ähnlich wie das bekannte Konzept MBSR (Mindfulness-Based- Stress-Reduction) von Jon Kabat-Zinn auf achtsamkeitsbasierten Elementen. Meditation, Innenschau, eine achtsame, freischwebende Aufmerksamkeit, bestimmte Atemtechniken, dies sind zentrale Elemente in der Introvision.
Während bei der Achtsamkeit jedoch die gelassene Haltung im Hier und Jetzt zentral ist, schauen wir in der Introvision auch auf die Vergangenheit. Klienten gehen in das Erleben einer vergangenen, unangenehmen Situation hinein, bleiben dabei aber in einer weitgestellten, konstatierenden Wahrnehmung. Sie fragen sich, was sie damals gedacht, erlebt, gespürt haben und beobachten dabei ihre Wahrnehmung.
Das innere Video wird erneut abgespielt und in der Haltung des KAW alles berücksichtigt, was auftaucht, alle Kognitionen oder Bewusstseinsinhalte. Entscheidend ist, dass man gelernt hat, weitgestellt und konstatierend zu bleiben, um diese Wahrnehmungshaltung während der Introvision konsequent anzunehmen und zu erhalten. Sonst kann man von seinem Erleben neu überwältigt werden. Erfahrene Berater führen ihre Klienten gezielt durch diesen Prozess. Wer geübt ist, kann dies mit eigenen Themen selbst tun.
Das Unangenehme, Schlimme für ein Weilchen ansschauen, eher ein paar Minuten als über einen längeren Zeitraum, das ist Introvision. Auf diese Weise stellt sich meist Entspannung ein, die Kraft zur Selbststeuerung wird wieder mobilisiert, der Druck lässt nach.
Es ist laut Prof. Dr. Wagner eine zentrale, bis heute faszinierende Erkenntnis aus der langjährigen Forschung, dass der Prozess, der Angst oder dem Schlimmen ins Gesicht zu schauen, etwas dauerhaft Auflösendes haben kann.
Introvision hilft, die Gedanken zu sortieren
Introvision passt nicht für jede/n und auch nicht für jede Situation. Aber mit der Methode des KAW kann man bereits in vielen Alltagssituationen die eigenen mentalen Prozesse regulieren. Denn im Alltag haben wir es normalerweise nicht mit großen, akuten Konflikten zu tun, sondern vielleicht nur mit einem beginnenden Gefühl des Unwohlseins, der Unstimmigkeit oder Unruhe.
Das KAW kann als Kreativitätstechnik, im Zeitmanagement, bei der Priorisierung oder der Sortierung der Gedanken angewendet werden. Eine Studie von Herwig, Kaffenberger et al. (2010) von der Universität Zürich kommt zu folgendem Ergebnis: Konstatierende Aufmerksamkeit führt innerhalb von elf Sekunden zu einer signifikanten Abnahme der Erregung in der Amygdala. Diese Hirnregion steuert einen Großteil der Emotionen und spielt eine zentrale Rolle bei Furcht, Bedrohung und andere Emotionen.
Die Erwartungen, die Sehnsüchte und der Leidensdruck der Menschen heute sind groß. Die Introvision ist genau die richtige Methode für unsere Gesellschaft. Die Zeit ist gekommen, sich mit den Prozessen des inneren Erlebens auseinanderzusetzen. Es kann sein, dass man nach einer Introvisionberatung bzw. einem -coaching einen Schatz gehoben hat. Das Empfinden, etwas Neues entdeckt, etwas Entscheidendes erkannt zu haben, kann eine starke Kraft hervorbringen. Dies kann man am besten mit Unterstützung erfahrener Introvisionsberaterinnen und -beratern tun.
Angela Rohde
Dr. Angela Rohde ist zertifizierte Introvisionsberaterin und Gründungs- und derzeit Vorstandsmitglied des Verein Introvision e.V. Sie ist promovierte Kommunikationswissenschafterin und arbeitete über 15 Jahre in der freien Wirtschaft in Marketing und Kommunikation, bevor sie sich 2015 in der Nähe von Hamburg als Beraterin und Coach mit dem Schwerpunkt Kommunikation und Trainings selbständig machte. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. www.rohde-kommunikation.de
Mehr zu Introvision
Wagner, Kosuch, Iwers-Stelljes: Introvision. Problemen gelassen ins Auge schauen. Eine Einführung. Kohlhammer 2016
Angelika C. Wagner: Gelassenheit durch Auflösung innerer Konflikte. Mentale Selbstregulation und Introvision. Kohlhammer, 2. Auflage 2011
Empl, Spille, Löser: Introvision bei Kopfschmerzen und Migräne. mvg Verlag 2017
Arbeiten und Aufsätze zur Introvision auf der Website der Forschungsgruppe Introvision: www.introvision.uni-hamburg.de
Introvision e.V. hat eine Liste der zertifizierten Introvisionsberater in Deutschland