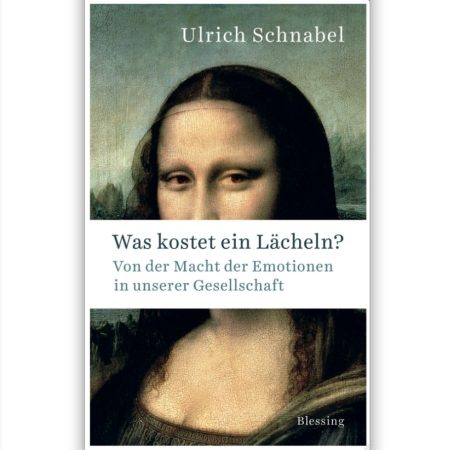Ein Buch des ZEIT-Redakteurs Ulrich Schnabel
Wissenschaftsredaketur Ulrich Schnabel hat ein Buch über Emotionen geschrieben. Denn sie sind die entscheidenden Triebkräfte des Lebens. Er gibt Anregungen, klug damit umzugehen und sich vor Manipulationen zu schützen, die gerade in der Konsumgesellschaft überall gegenwärtig sind.
Wie kommt ein gestandener Wissenschaftsjournalist wie Dr. Ulrich Schnabel darauf, ein Buch über Emotionen zu schreiben? Die Antwort ist einfach: Emotionen bestimmen unser Leben oft mehr, als uns lieb und auch bewusst ist. Und ihre Macht reicht weit über unser persönliches Leben hinaus – bis in Politik und Gesellschaft hinein. Daher ist es auch ein Ziel seines neuen Werkes, Anregungen dafür zu geben, wie wir uns vor emotionaler Manipulation schützen können.
Schnabel, der vor fünf Jahren mit dem Buch „Muße“ einen Bestseller landete, erforscht das Thema als neugieriger Beobachter und nimmt den Leser mit auf seine Spurensuche. In guter journalistischer Manier informiert er sich bei Psychologen, Hirnforschern, Soziologen und Philosophen. Das abgeschöpfte Wissen fließt, teilweise auch in Form kurzer Wortlaut-Interviews, in das Buch ein.
Schnabel widmet sich drei großen Themen: Im 1. Teil „Achterbahn der Gefühle“ geht es um die Einsicht, wie sehr wir in unseren Emotionen oft von anderen beeinflusst sind. Je nachdem, wie stark unsere emotionale Widerstandskraft ist, können wir der emotionalen Ansteckung etwas entgegensetzen oder nicht. Zum Thema Gefühle und Glück gibt es ein eigenes Kapitel – hier setzt sich Schnabel mit Glücksvorstellungen und Illusionen auseinander, von denen ganze Industriezweige profitieren. Interessant ist die Beobachtung des Autors, dass das Kreisen um die eigene Befindlichkeit zur Entsolidarisierung der Gesellschaft führe.
Im 2. Teil „Vom Wesen der Emotionen“ lernt man, welche Bedeutung Gefühle für das menschliche Leben haben, wie sie in Beziehung zu engen Bezugspersonen entstehen und wieso man sie als „unseren 1. Verstand“ bezeichnen kann. Dem Leser wird klar gemacht, dass wir ohne soziale Resonanz kaum überleben könnten. Hier werden u.a. Ansätze von Emotionsforschern wie Antonio Damasio und Paul Ekman skizziert.
Im 3. Teil „Liebe, Arbeit, Mitgefühl“ schreibt Schnabel über Gefühle in bestimmten Kontexten. Insbesondere weist der Autor auf „emotionale Fallen“ hin: Paarbeziehungen würden überfrachtet mit idealistischen Vorstellungen und dem Streben nach dem perfekten Glücksempfinden. In der Arbeitswelt würden Emotionen instrumentalisiert: Führungskräfte lernten, „emotional zu führen“, Servicepersonal werde darin geschult, gute Gefühle in Kunden zu erzeugen. Als Beispiel nennt der Autor Stewardessen, die sich vorstellen müssen, das Flugzeug sei ein Wohnzimmer, die Passagiere seien Freunde, für deren angenehme Empfindungen man zu sorgen habe.
Am Ende geht Schnabel auf mögliche Lösungen ein, wie wir unsere eigenen Emotionen wahrnehmen und emotionaler Fernsteuerung entkommen können. Stichworte sind hier Meditation, emotionale Aufmerksamkeit sowie eine ausgewogene Entwicklung von Mitgefühl und Vernunft.
Das Hilfreiche an dem Buch ist, dass Schnabel zwar für das wichtige Thema Emotionen sensibilisieren möchte, dies jedoch nicht als Ratgeber, Küchenpsychologe oder Achtsamkeitstrainer tut, sondern als Journalist: Er trägt zusammen, was es an wissenschaftlichen Studien, Erkenntnissen und Geschichten zum Thema gibt. Die Verantwortung bleibt beim Leser: Dieser muss selbst herausfinden, wie ein kluger Umgang mit Emotionen aussehen könnte.
Allerdings wird er, angeregt durch das Buch, vielleicht bewusster mit den eigenen Emotionen und denen der anderen umgehen. So kann ganz natürlich emotionale Intelligenz wachsen: eine Intelligenz, die Gefühle nicht ignoriert, ihnen aber auch nicht blind vertraut.
Birgit Stratmann