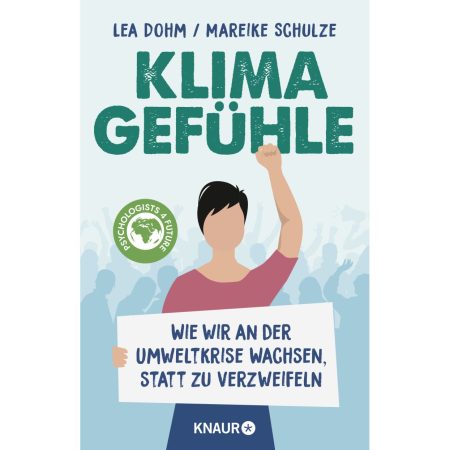Ein Buch der Psychologists für Future
Das Verdrängen der Klimakrise ist ein großes Hindernis für eine wirkungsvolle Politik. Daher müssen wir lernen, uns Gefühlen von Angst, Ohnmacht und Wut zu stellen, so die Gründerinnen der Psychologists for Future. In ihrem Buch erklären sie, wie wichtig diese Gefühle sind, um ins Handeln zu kommen. Und sie erzählen die Geschichte ihres eigenen Engagements.
Es gibt Bücher, die holen einen emotional genau da ab, wo man gerade ist. Solch ein Buch ist „Klimagefühle“ von Lea Dohm und Mareike Schulze. Die beiden Gründerinnen von Psychologists for Future erklären, warum die Klimakrise auf die Psyche schlägt und was wir tun können, um dennoch handlungsfähig zu bleiben.
Die beiden Psychotherapeutinnen beschreiben aus eigener Erfahrung Strategien für den Umgang mit Traurigkeit, Ärger, Furcht und Schuld. Und sie erklären, wie wir trotz Krise psychisch gesund bleiben, wie Aktivwerden dabei helfen kann und wie durch Handeln Freude, Verbundenheit und sogar Zuversicht und Mut entstehen können.
Sie scheuen dabei auch nicht die harten Themen wie den Neid oder die Wut auf Zeitgenossen, die noch immer unbekümmert mit dem Flugzeug die Traumziele dieser Welt ansteuern, die Sehnsucht nach der guten alten Zeit, oder die beklemmende Frage, ob man in diese Welt eigentlich noch Kinder setzen kann.
Unterfüttert wird das praxisnahe Werk mit emotionalen Erfahrungsberichten von prominenten Forschenden, Aktivistinnen und Engagierten wie Carola Rackete, Claudia Kemfert, Harald Lesch, Eckart von Hirschhausen, Özden Terli oder Stefan Rahmstorf.
Letzterer ist Professor am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und sagt: „Die Klimakrise wird den Rest unseres Lebens überschatten und verändern. Das löst unangenehme Gefühle aus. Dieses Buch macht Hoffnung und hilft, dass die Gefühle zum Handeln motivieren, statt zu lähmen“.
Warum wir nicht handeln
Rahmstorf steht wie sein Professorenkollege Mojib Latif, der als Präsident der Deutschen Gesellschaft Club of Rome fungiert und das Vorwort geschrieben hat, oft fassungslos davor, wie lange schon alles Wesentliche zur Klimakrise bekannt ist, und wie tatenlos die Menschheit immer noch ist.
Latif weiß, dass eine Revolution des Denkens nicht ohne eine Revolution des Fühlens geht. „Um aus der Verleugnung der Klimakrise herauszukommen, müssen wir uns emotional mit ihr auseinandersetzen“. Dies zu leisten, haben sich Lea Dohm und Mareike Schulze aufgemacht.
Bei Mareike Schulze beginnt alles 2018 mit gleich mehreren Ereignissen: der Geburt ihrer Tochter, dem ersten Schulstreik von Greta Thunberg sowie einem Hitzesommer, wie ihn Deutschland noch nicht gesehen hatte. Sie erlebt eine Politisierung im Turbogang.
Schulze beginnt zu begreifen, wie Klimasysteme zusammenwirken und was es für Ökosysteme bedeutet, wenn Arten aussterben. Sie steht unter Schock, durchlebt Phasen tiefer Trauer und heftiger Schuld, als ihr die globalen Zusammenhänge bewusstwerden. Und dann kommt die Wut. Auch auf den eigenen Berufsstand. Sie postet ihre Gedanken auf den Sozialen Medien. Und begegnet dabei einem Menschen, der das genau so sieht: Lea Dohm.
Unbequeme Wahrheit
Dohm ist Mutter von zwei kleinen Kindern, ebenfalls in psychotherapeutischer Praxis tätig und beginnt über die heraufziehenden Ökokatastrophen zu lesen. „Das Gefühl, das mich in diesen Tagen und Wochen erfasst, entspricht dem, was wir wohl erfahren, wenn wir eine unbequeme Wahrheit herausfinden, die unsere bisher sicher geglaubten Grundfesten erschüttert“, schreibt sie.
Sie nimmt im März 2019 an ihrer ersten „Fridays for Future“-Demo teil. Das Engagement macht Mut, erzeugt aber auch Handlungsdruck. Dann sieht sie Mareike Schulzes Post und entdeckt, dass ihre Berufsgruppe diverse Anknüpfungspunkte an die Klimaproteste hat: Die Geburtsstunde der „Psychologists for Future“ in Deutschland.
Was dann kommt, ist eine echte Erfolgsgeschichte. Zwischenzeitlich gibt es über 40 Regionalgruppen, 30 Arbeitsgruppen. Die 36 größten Psychotherapie-Verbände taten sich zusammen und riefen zu konkreten Aktionen auf. Das ist viel, wenn auch noch nicht der große, gesellschaftliche Wandel, der notwendig wäre.
Dafür braucht es nach Ansicht der Autorinnen Zeit und Raum, Gespräche und Gefühle. Gerade darum soll es gehen. Zu entdecken, was wir in Bezug auf die Klimakrise fühlen und gemeinsam zu überlegen, wie wir gut und konstruktiv damit umgehen können.

Vielleicht ist das das größte Verdienst des Buches, dass es deutlich macht, wir und unsere Klimagefühle sind in Ordnung, auch wenn sie ambivalent sind, uns ängstigen, lähmen, empören – und manchmal nicht leicht im Zaum zu halten sind.
„Hoffnung kann aus dem Handeln heraus entstehen“, formulieren es die Autorinnen. Das Gefühl, den eigenen Beitrag zu leisten, sein Bestes zu geben – mit anderen Menschen zusammen, das trägt.
Manchmal hilft dann auch nur die radikale Akzeptanz, also das Annehmen unliebsamer Tatsachen, aber nur, um sorgsam unterscheiden zu können, an welchen Stellen wir noch etwas ändern können.
„Wir haben jetzt keine Zeit aufzugeben“, appellieren die Autorinnen. Als Psychologinnen wissen sie auch um so genannte soziale „Tipping Points“, also Kipppunkte. Das heißt: Wenn mindestens 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung inhaltlich von einer Sache überzeugt sind und etwa drei Prozent sich aktiv dafür einsetzen, sind sehr schnell, sehr weitgreifende gesellschaftliche und politische Veränderungen möglich.
Kirsten Baumbusch
Lea Dohm und Mareike Schulze, Klimagefühle, Wie wir an der Umweltkrise wachsen, statt zu verzweifeln, Knaur 2022.