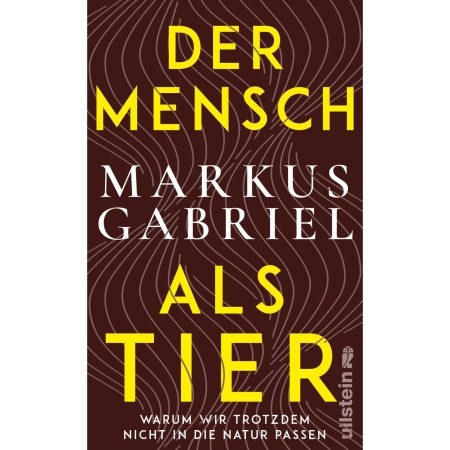Drei Bücher zur Tierethik
Tiere tragen ihren Wert in sich – mit diesem Gedanken beschäftigen sich einige neue Bücher zur Tierethik. Mike Kauschke stellt drei Werke vor, die Tiere als Subjekte zeigen – mit ihrer eigenen Lebendigkeit. Und diese gilt es zu schützen. Nur der Mensch kann sich bewusst für ein ethisches Verhalten gegenüber Tieren entscheiden.
Unsere Beziehung zu den Tieren kommt zunehmend ins gesellschaftliche Bewusstsein. Das zeigen die steigenden Zahlen von Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren oder die Diskussionen um ein Label für Tierwohl auf Fleischprodukten.
Unterstützt wird diese Entwicklung auch durch wissenschaftliche Forschungen, die das Verständnis unserer Mitlebewesen immer mehr erweitert. Längst ist klar, in welchem Umfang sie empfindende, soziale Wesen sind, die in einer Vielzahl von Wechselwirkungen mit Pflanzen, Pilzen und Kleinstlebewesen in das Gewebe des Lebens eingewoben sind. Nicht als passive völlig vorherbestimmte Objekte, sondern als Subjekte, die ihre eigene Lebendigkeit spüren, bewahren und vermehren wollen.
In der letzten Zeit sind einige Bücher erschienen, die auf diesem neuen Verständnis der Tiere aufbauen und es erweitern wollen. Sie fragen auch danach, was dies für unser Zusammenleben mit ihnen und für unsere ethischen Entscheidungen bedeutet.
Ed Young: „Die erstaunlichen Sinne der Tiere“
Einen tiefen Blick in die Wunderwelt tierischen Lebens bietet das Buch „Die erstaunlichen Sinne der Tiere“ des Wissenschaftsjournalisten Ed Young. Er hat sich intensiv mit den Sinnen der Tiere beschäfitgt und zeigt eindrücklich auf, dass jede Spezies in ihrem eigenen Wahrnehmungsraum lebt, der ihr eine bestimmte Umwelt erschließt. Aus dieser sind aber viele Bereiche der übervollen Erde ausgeschlossen.
Das gilt auch für uns Menschen. Die Welt, die wir wahrnehmen, ist nicht die ganze Welt. Das können uns unsere Schöpfungsgeschwister lehren. Haie spüren schwache elektrische Felder, Rotkelchen können Magnetfelder wahrnehmen, Robben verfolgen die unsichtbaren Spuren der Fische. Spinnen spüren die Luftströmung einer Fliege. Nagetiere hören Ultraschallrufe, Elefanten Infraschallgeräusche. Schlangen sehen Infrarotstrahlung, Bienen das ultraviolette Licht.
Wenn wir seinen Schilderungen dieser verschiedenen Wahrnehmungswelten der Tiere folgen, kann sich auch das Verständnis und Spüren des Lebendigen erweitern: „Wenn wir anderen Tieren unsere Aufmerksamkeit schenken, wird unsere eigene Welt weiter und tiefer. … Von einer Umwelt in die andere zu treten oder es zumindest zu versuchen, ist, als würde man einen fremden Planeten betreten.“
Zudem erfahren wir von unendlich vielen Weisen, wie sich Tiere an wechselnde Umweltbedingungen angepasst haben. Ein Wissen, das im Umgang mit den Folgen der Klimakrise für uns wichtig sein kann. Aber „Tiere sind nicht nur Stellvertreter für Menschen oder Futter für die Suche nach Ideen. Sie tragen ihren Wert in sich selbst“, so Yong.
Melanie Challenger: „Wir Tiere“
Der innewohnenden Würde der Tiere geht die Umweltphilosophin Melanie Challenger in ihrem Buch „Wir Tiere“ nach. Vor allem geht es ihr darum, wie sich unser Verständnis von uns selbst verändert, wenn wir die Tiere als Subjekte mit eigener Selbstbestimmung, vielleicht sogar einem Personsein verstehen.
Sie möchte die Trennung zwischen den Menschen und den anderen Tieren infrage stellen. Denn, so schreibt sie, „wie alle irdischen Lebewesen entstammen wir gemeinsamen Prozessen, einem Verbund von Materie, die sich in die scheinbar grenzenlosen Wunder des Lebens verwandeln kann. Gleichzeitig besitzen wir eine Psyche, mit der wir uns und unsere Situation wahrnehmen können. Das alles macht uns zu etwas, das uns fasziniert und Angst macht. Wir sind ein Tier.“
In ihrem Buch zeigt sie mittels wissenschaftlicher Studien auf, wie sehr auch die Menschen in das Gewebe des Lebens eingewoben sind und nur durch ihr Tiersein existieren. „Es gibt keine feste Grenze zwischen uns und anderen Tieren“, schreibt sie.
„Gene bedeuten immer Veränderung, Mutation, Krankheit und Verwicklung. Unser Körper ist durchlässig, er nimmt Duftstoffe oder Parasiten auf und assimiliert gar die DNA anderer Lebewesen. Nichts an uns ist von Dauer. Unser Körper ist eine erhabene und widerspenstige Zellkolonie und unser Verstand ein fließender, chamäleonhafter Prozess.“
Aus dieser Erkenntnis der Verwobenheit mit dem Lebendigen kann sich der Umgang mit den Tieren und der ganzen Schöpfung radikal verwandeln, davon ist Melanie Challenger überzeugt.
Statt das Lebendige zu vernutzen und zerstören, können wir gemeinsam mit den anderen Lebewesen neue Wege des Zusammenlebens finden, die unseren Planeten bewahren. Das ist eine inspirierende Vision, die dieses Buch eindringlich vermittelt.
Markus Gabriel: „Der Mensch als Tier“
Die Frage, ob der Mensch „nur“ ein besonderes Tier ist oder ob er durch seine geistigen Fähigkeiten eine besondere Rolle im Gewebe des Lebendigen innehat, bleibt aber kontrovers. Und es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.
Dieser Ansicht ist auch der Philosoph Markus Gabriel, einer der renommiertesten deutschsprachigen Philosophen unserer Zeit. Sein neues Buch „Der Mensch als Tier“ beschäftigt sich mit der Frage: Was ist der Mensch?
Dabei geht Gabriel auf die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse ein, welche die seiner Ansicht nach „falsche Naturphilosophie“ der Moderne überwinden können. Diese sagt, dass „die Natur als eine große Maschine zu betrachten sei, in der es bis auf das Treiben der Menschen geist- und bewusstlos zugeht“.
Gabriel erklärt, dass wir einfach nicht wissen, welche Formen von Bewusstsein und Intelligenz dem Lebendigen innewohnen. Die neuen Forschungen des Lebendigen, wie sie in den ersten beiden Büchern dargelegt werden, deuten darauf hin, dass es ganz verschiedene Formen von Intelligenz geben kann, etwa der Interaktion von Bakterien, der Vernetzung der Bäume untereinander und dem Leben der Tiere mit ihren je eigenen Wahrnehmungswelten.
Aufgrund unserer eigenen Naturhaftigkeit kommt Gabriel zu dem Schluss, „dass wir den Menschen als Tier nicht loswerden. Wir sind und bleiben verwundbare, endliche und begrenzte Lebewesen, die sich aber über diesen Status bewusst werden können.“
Verantwortung übernehmen für die Mitwelt
Die geistige Selbsterkenntnis des Menschen begründet für Gabriel dessen besondere Verantwortung. Sie wurzelt im Geistigen, deshalb wendet sich der Philosoph gegen Versuche, den Unterschied zwischen menschlichem Geist und Natur zu nivellieren. Wer die Realität des menschlich Geistigen verleugnet, leugne die Grundlage der Ethik.
Denn Ethik sei eine geistige Fähigkeit, die nur dem Menschen eigen ist. „Die Ethik“, so Gabriel „ergibt sich aus der Selbsterkenntnis des geistigen Lebewesens namens Mensch, das sich selbst als Tier erkennen kann, das keines sein will.“
Gerade weil wir anders als die anderen Tiere sind, geistige Wesen mit ethischer Entscheidungsfähigkeit und Verantwortlichkeit, können und müssen wir uns entscheiden, ethisch mit unserer Mitwelt umzugehen.
Zudem sieht er gerade in einem materialistischen Weltbild, das keinen Raum für das Geistige als Wirklichkeit lässt, die Hauptursache der Krisen die zu „einer drohenden Selbstausrottung“ geführt haben.
Demut gegenüber dem Leben
Als Gegenmittel zur Hybris der Moderne formuliert Gabriel eine „Ethik des Nichtwissens“, die ihren Ausgangspunkt nimmt in einer „epistemischen Bescheidenheit. Es ist ein Wissen darum, dass unsere Wissensansprüche bezüglich der Natur sowie unsere konkreten Wertvorstellungen und ethischen Urteile fehleranfällig und korrekturbedürftig sind. Diese epistemische Bescheidenheit gründet in unserem Respekt vor dem anderen, das uns immer fremd bleibt.“
Diese Demut, dieser Respekt ist wohl die Grundlage einer neuen Koexistenz mit dem Lebendigen, in der die ethischen Entscheidungen aus der Erkenntnis und Erfahrung unserer Teilhabe am Gewebe des Lebens kommen.
Dabei ist es zweitranging, ob wir den Respekt dadurch empfinden, dass wir unsere Nähe zu den anderen Tieren fühlen oder unsere besondere Rolle als Menschen verstehen und annehmen, was ja eigentlich kein Widerspruch sein muss.
Über diese dringenden Fragen nachzudenken und ins Gespräch zu kommen, bieten diese Bücher zahlreiche Anregungen.
Ed Young. Die erstaunlichen Sinne der Tiere. Erkundung einer unermesslichen Welt. Verlag Antje Kunstmann 2022
Melanie Challenger. Wir Tiere. Eine neue Geschichte der Menschheit, btb Verlag 2021
Markus Gabriel. Der Mensch als Tier. Warum wir trotzdem nicht in die Natur passen. Ullstein 2022