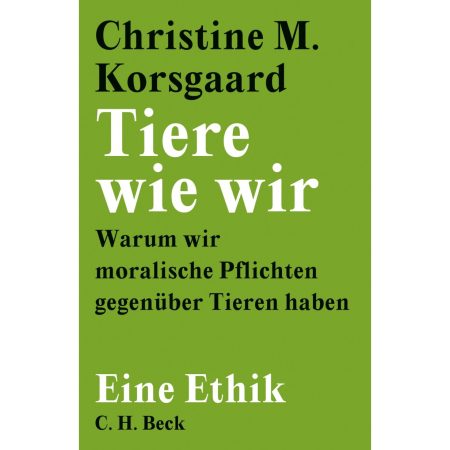Eine Auseinandersetzung mit Kant
Wer sich mit Tierethik beschäftigt, kommt um dieses Buch der Harvard-Professorin Christine M. Korsgaard nicht herum. Die Autorin begründet detailliert, warum Tiere „ein Zweck an sich selbst“ im Sinne Kants sind und nicht weniger wichtig als Menschen. Philosophisch anspruchsvoll und mit weitreichenden Konsequenzen für Politik und Gesellschaft.
In ihrem philosophischen Buch versucht Christine M. Korsgaard mithilfe des Kantischen Instrumentenkoffers zu zeigen, dass wir gegenüber Tieren dieselben moralischen Pflichten haben wie gegenüber Menschen. Die Argumentation ist einigermaßen verwickelt. Das Buch ist aber, dies vorweg, sehr klar und flüssig geschrieben, also viel besser lesbar als Kant.
Kant begründet moralische Pflichten Menschen gegenüber damit, dass diese ihre eigenen Zwecke haben und deshalb von anderen Menschen nicht zum Mittel für deren Zwecke gemacht werden dürfen.
Vernünftige Wesen haben sich, so Kant, wechselseitig ein moralisches Gesetz gegeben und damit eine moralische Gemeinschaft gebildet, die er das Reich der Zwecke nennt. Die anderen Tiere – Korsgaard spricht durchgehend von menschlichen und nichtmenschlichen Tieren – konnten an dieser wechselseitigen Gesetzgebung nicht teilnehmen und gehören somit der moralischen Gemeinschaft auch nicht an.
Die Autorin möchte die Widersprüchlichkeit dieses Ausschlusses nachweisen. Sie möchte also, anders als Kant, die nichtmenschlichen Tiere in die Ethik einbeziehen. Man kann sagen, dass das gelingt, allerdings ist die Sache kompliziert.
Auch ein Tier ist ein Zweck für sich selbst
„Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als auch in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals als bloßes Mittel brauchest“. Diese Fassung des kategorischen Imperativs macht deutlich, was Kant mit „Zweck“ meint.
Es geht darum, dass Menschen jeweils eigene Ziele verfolgen, die unbedingt geachtet werden müssen. Sie nicht zu achten wäre die Nicht-Achtung der freien Zieldefinition des anderen und damit die Nicht-Achtung der Freiheit selbst. Das kann aber ein rationales Wesen nicht wollen.
Freiheit ist in erster Linie die Freiheit des Anderen, denn meine eigene Freiheit führt bestenfalls zur Verwirklichung meiner Wünsche, ist demnach wesentlich interessengebunden. Daraus allein entsteht keine Würde, kein Recht, keine Person. Erst durch die Achtung der Freiheit des Anderen werde ich zu einem moralischen Wesen.
Korsgaards argumentiert nun, dass auch Tiere Ziele haben, die sie durch Handlungen verfolgen, auch wenn sie selbst nicht rational, sondern instinktiv handeln. Auch sie besitzen ein höchstes Gut, z.B. weiter zu leben, sich fortzupflanzen und alles was dazu gehört.
Das ausschlaggebende Argument für die Achtung eines Wesens sei im Kantischen System nicht die Rationalität, sondern die Anerkennung der Tatsache, dass es ein höchstes Gut gibt, das es verfolgt. Deshalb müsse aus seiner Ethik abgeleitet werden, dass auch Tiere Anspruch auf Achtung hätten und nicht als „bloßes Mittel“ zu unseren Zwecken gebraucht werden dürften.
Korsgaard verwirft die Bedingung der Wechselseitigkeit als zwingende Voraussetzung für einen moralischen Status und zeigt, dass Kant sich hier von seiner eigenen Voraussetzung entfernt. Mit diesem Argument schloss Kant die Tiere aus.
Tiere können zwar nicht in eine wechselseitige Gesetzgebung eintreten, können (und müssen) aber dennoch Objekte der Achtung vernünftiger Wesen werden, da sie selbst auch Zwecke für sich selbst sind.
Wie sieht es mit Pflanzen aus?
Kant war hingegen von einer grundsätzlichen Identität von passiver und aktiver Setzung eines Zweckes für sich selbst ausgegangen, wie es für Menschen auch zutrifft. Aktiv: Ich kann (und soll) so handeln, dass meine Handlung zum Gesetz für alle werden könnte, indem ich alle anderen als Wesen anerkenne, die Zwecke für sich selbst verfolgen. Passiv:Ich kann (und werde in der Regel) von den anderen auch als ein solches Wesen anerkannt werden.
Den ersten Teil dieser wechselseitigen Abmachung können Tiere offenbar nicht verfolgen. Korsgaard stellt nun aber fest, dass der zweite Teil davon nicht berührt wird und deshalb Tiere gemäß der Kantischen Ethik nicht als Mittel zum Zweck benutzt werden dürfen. Soweit so schlüssig.
Durch die Trennung von aktiver und passiver Achtung und dem Eingeständnis, dass Tiere uns wohl niemals als Zwecke für sich selbst anerkennen werden – der Löwe wird auch den Vegetarier verspeisen, wenn er ihn kriegen kann – handelt sich die Autorin allerdings die Unabschließbarkeit ihres Anspruches ein.
Das heißt, dass nach der Argumentation Korsgaards der Mensch für alle lebenden Wesen, ethische Verantwortung trägt. Alle lebenden Wesen haben Zwecke für sich selbst. Es ist kaum begründbar, dass z.B. Pflanzen nicht mit einbezogen werden sollen. Auch sie leiden, wenn sie abgeschnitten oder nicht gewässert oder ohne ausreichendes Licht gehalten werden. Auch sie verfolgen ihre Zwecke, streben, Tieren sehr ähnlich nach Nahrung, Wasser und Reproduktion.
Zwar handeln Pflanzen nicht wie Menschen und Tieren, aber betrachtet man ihr Wurzelwachstum in die Richtung guter Nährstoffe, ihr Wachsen ins Licht, ihre Kommunikation mit ihresgleichen und mit anderen Pflanzen, wäre es sehr willkürlich, diese Prozesse nicht als Handlungen zu bezeichnen.
Die Autorin scheint das auch selbst zu merken, indem sie sehr ausführlich den Anspruch von Jeff McMahan diskutiert, der verlangt, Menschen hätten nicht nur die Pflicht, das Leid zu stoppen, das sie selbst Tieren antun, sondern auch das, das Tiere sich untereinander antun. Das heißt, wir sollten verhindern, dass Tiere die Beute von anderen Tieren werden. Es sollte durch menschliche Einwirkung nur noch Pflanzenfresser geben. Dieser, mit Verlaub, verrückte Plan wird von Korsgaard über zwei Kapitel ernsthaft diskutiert und in eine Antinomie überführt.
Folgte man McMahans Ansprüchen, müsste man alle Prädatoren, also Organismen, die einen anderen zum Zweck der Nahrungsaufnahme nutzen, ausrotten und nur noch Pflanzenfresser leben lassen. Auch diese müsste man dezimieren, weil sie keine Feinde mehr hätten.
Alle Tiere wären dann unter menschlicher Kontrolle. Das kann niemand wollen, und man kann seigentlich auch nicht ernsthaft diskutieren. Dass die Autorin dies aber trotzdem tut, zeigt, dass es mit ihrer Argumentation schwierig wird, dem moralischen Anspruch, der an Menschen gestellt wird, noch irgend eine Grenze zu weisen.
Obwohl ich mit dem Ziel der Autorin, Tiere als eigenwertige Wesen zu achten, übereinstimme, kann ich ihrem Weg dahin nicht folgen. Das liegt im Kern daran, dass die subjektzentrierte Ethik Kants nicht überzeugt. Die Autorin weist auf einen Fehler darin hin, stützt sich aber dennoch weitgehend auf dieses Gerüst.
Trotzdem ist es ein gut geschriebenes, manchmal auch wirklich komisches Buch, welches das Thema mit zahlreichen Facetten und originellen Gedanken beleuchtet. Für philosophisch interessierte Leserinnen und Leser lohnt es sich zu lesen. Und es ist auch eine Aufforderung an uns als Gesellschaft, darüber nachzudenken, wie wir Tiere behandeln, z.B. in der Massentierhaltung.
Carsten Petersen
Christine M. Korsgaard. Tiere wie wir. Warum wir moralische Pflichten gegenüber Tieren haben. C.H. Beck 2021