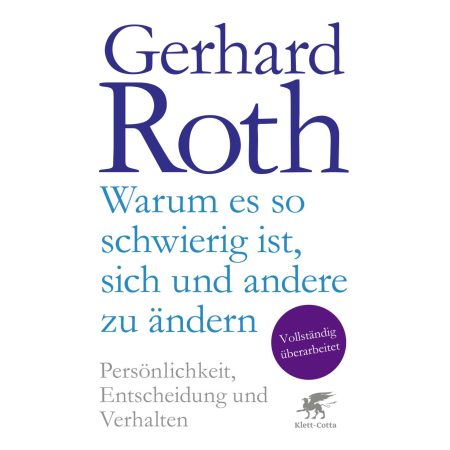Gerhard Roth hat sein Grundlagenwerk überarbeitet
Warum erlaubt uns das Gehirn nur in begrenztem Maße, uns zu verändern? Was ist es, das uns begrenzt? Darum dreht sich das Buch des Neurowissenschaftlers Gerhard Roth. Er erklärt die psychologischen und neurobiologischen Grundlagen von Persönlichkeit, Entscheidung und Veränderung. Einige offene Fragen bleiben.
Der Neurowissenschaftler Gerhard Roth macht immer wieder mit provokanten Aussagen von sich reden. So ließ er sich am 11. Dezember 2021 im Interview mit Spiegel online zu dem Satz hinreißen, dass nur 20 Prozent der Bevölkerung vernünftigen Argumenten zugänglich seien. Eine Impfplicht sei daher das Beste, um die Uneinsichtigen auf Kurs zu bringen.
Nun hat er das Buch „Warum es so schwierig ist, sich selbst und andere zu verändern“ herausgebracht, in dem er Grundlagenwissen auf der Basis seines neurowissenschaftlichen Weltbildes vermittelt. Es ist die vollständig überarbeitete Fassung seines Werkes von 2007 „Persönlichkeit, Entscheidung und Verhalten – Warum es so schwierig ist, sich und andere zu ändern“, denn die Erkenntnisse in der Wissenschaft schreiten voran und Neues musste integriert werden.
Bei allen Neuerungen, die er vorstellt, bleibt Roth bei seiner früher schon vorgetragenen These, dass der Mensch nur begrenzt in der Lage ist, sich zu wandeln.
Grundzüge der Persönlichkeit werden früh herausgebildet
In 17 Kapiteln vermittelt der Wissenschaftler Erkenntnisse über das menschliche Gehirn und die psychologischen und neurobiologischen Merkmale von Persönlichkeit, Motivation, Entscheidung und Veränderung.
Die Kernaussage ist, dass Menschen sich zwar bis ins hohe Alter ein wenig verändern können, es aber eigentlich nicht tun. Zu stark seien die Konstanten, die Grundzüge der Persönlichkeit. Und diese würden früh ausgeprägt, etwa ob jemand dynamisch und offen für Veränderungen ist, oder konservativ mit der Tendenz, immer für stabile Verhältnisse zu sorgen.
Weitere Themen sind Intelligenz, wie sie sich herausbildet, und das Zusammenspiel mit Gefühlen, also was wir bewusst empfinden, und Emotionen, die uns zum Handeln bewegen. Weiter erklärt Roth Bewusstsein und das Unbewusste und denkt über die Frage nach, was eigentlich maßgeblich unsere Entscheidungen bestimmt.
Lehrreich ist zu lesen, dass für verschiedene Entscheidungen unterschiedliche Strategien gebraucht werden, je nachdem, wie komplex die Situation ist. Klar ist laut Roth, dass – laienhaft ausgedrückt – das limbische System, also tief sitzende Gefühle, in unserem Leben die Oberhand haben.
Roth setzt sich auch mit der Frage auseinander, wie wir andere verändern können, etwa als Führungskraft im Unternehmen. Die Frage ist allerdings, warum wir das tun wollen und ob es überhaupt sinnvoll ist.
Wir verdanken Roth, dass er Laien mit diesem Buch auf den aktuellen Stand der Forschung bringt. Es ist hilfreich, sich die biologischen Grundlagen des Lebens vor Augen zu führen und zu sehen, was uns als Menschen möglich ist und wo unsere Grenzen liegen.
Klar und plausibel ist: Menschen können ihre Persönlichkeit, die sich in früher Kindheit formt, nicht vollständig umkrempeln. Zu tief sitzen Gewohnheiten und Prägungen. Zu stark wirken unbewusste Erlebnisse, Traumata.
Welche Veränderungen streben wir eigentlich an?
Und doch, das ist Thema des 14. Kapitels, „Über die Möglichkeit, sich selbst zu verstehen und zu verändern“, gibt es Spielräume und Aspekte, die förderlich sind für Veränderungen, z.B. eine klare Zielsetzung, Gewöhnung und Selbstbelohnung.
Zu ergänzen wäre noch – das steht nicht im Buch – die Praxis der Achtsamkeit. Übende können mit einiger Erfahrung einen inneren Bewusstseinsraum öffnen und schauen, was ist, was geschieht, welche Kräfte gerade wirken.
Das allein kann Veränderungen bewirken, aber in einem anderen Sinne: Weniger impulsiv reagieren, die Muster und Gewohnheiten, die die Persönlichkeit bilden, durchschauen und mehr im Kontakt sein mit der dynamischen Wirklichkeit. Dadurch kann mehr Verständnis für andere entstehen und mehr Milde und Freundlichkeit gedeihen.
Die Kernfrage, was eigentlich sinnvolle Veränderungen sind, wird in dem Buch kaum besprochen. Und weitere Fragen bleiben offen: Warum hat die Evolution so etwas wie Bewusstsein überhaupt hervorgebracht – mit all den Fähigkeiten zu denken, zu planen, zu reflektieren, zu sprechen? Warum engagiert sich Roth, der ein eigenes Institut gegründet hat, für Change Management, wenn es so wenige Spielräume für Veränderungen gibt?
Tatsache ist, dass es einen enormen Zuwachs an wissenschaftlichen Erkenntnissen gibt, dass sich die menschliche Welt, gerade im Zuge der Digitalisierung, rasant verändert. Wie ist das möglich, wenn der Mensch so sehr auf Bestehendem beharrt?
Birgit Stratmann
Gerhard Roth. Warum es so schwierig ist, sich und andere zu verändern. Persönlichkeit, Entscheidung und Verhalten. Köln 4/2021