Ein Gedankenexperiment
Nach anfänglicher spontaner Willkommenskultur für Asylsuchende in Deutschland drohen nun wieder rückwärtsgewandte Überlegungen das Handeln zu bestimmen. Der Philosoph Florian Goldberg regt an, Deutschland von der Zukunft her zu denken. Wie stellen Sie sich das Land in 30 Jahren vor?
Vor kurzem saß ich mit einem Bekannten auf dem Balkon seiner Potsdamer Wohnung. Die Sonne schien auf Erdbeerkuchen und Kaffee, der Blick fiel freundlich auf die rings gelegenen Villen, im Sträßchen parkten Mittelklassewagen. Nach liebenswürdigem Geplänkel kam der Bekannte, ein promovierter Germanist, auf die Flüchtlingskrise zu sprechen.
Unerträglich sei es, sagte er, dass immer mehr Menschen ins Land strömten, die es unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe in erster Linie auf unser Sozialsystem abgesehen hätten. Es drohe, gab er sich überzeugt, erst eine wirtschaftliche, dann die kulturelle Katastrophe. Schon heute habe die Überfremdung bedrohliche Ausmaße angenommen. Ganze Viertel existierten in Berlin, in die man sich als Deutscher nicht mehr wagen dürfe bei all den Türken, Arabern, Albanern. Die nationale Identität erodiere. „Was ist denn heute“, rief er aus, „ noch richtig deutsch?“
Mir gingen tausend Dinge durch den Kopf, die ich hätte erwidern wollen. Ob er und die Millionen weiteren ehemaligen DDR-Bürger nicht auch unter anderem so etwas wie Wirtschaftsflüchtlinge gewesen waren, die ich mit meinem Solidaritätsbeitrag seit 25 Jahren klaglos subventioniere. Oder ob nicht mancherorts die Unterfremdung viel bedrohlichere Ausmaße annimmt als ihr angebliches Gegenteil. Immerhin gibt es in den östlichen Randzonen der Republik sogenannte „national befreite“ Ortschaften, in welchen ich mich auf die Standards zivilisierten Zusammenlebens weitaus weniger verlassen würde als im Wedding oder in Neuköln.
Deutschland neu erfinden
Um aber das Gespräch nicht unnötig eskalieren zu lassen, trug ich lediglich einen Gedanken vor, der mich schon längere Zeit beschäftigt. Was, wenn wir aufhörten, Deutschland und Deutschsein aus der Vergangenheit zu definieren und unser Land von der Zukunft her neu erfänden, ein Ziel setzten, eine ideale Szene kreierten, auf die hin zu leben unserem heutigen Denken und Handeln den Rahmen und die Richtung gäbe?
„Ja“, rief der Bekannte, „immer die Fixierung auf diese unsäglichen 12 Jahre Drittes Reich, das muss mal ein Ende haben!“
Ein Missverständnis, das ich höflich ignorierte. „Denk dir“, sagte ich, „das Jahr 2045. Wir feiern 100 Jahre kluger Kompromisse und damit 100 Jahre Frieden und Wohlstand. Die Europäische Gemeinschaft ist ein föderaler, demokratischer Staat mit friedlicher Ausstrahlung in die Welt.
Es herrscht wirkliche Gleichheit zwischen den Geschlechtern, den sexuellen Orientierungen, den religiösen Bekenntnissen. Man gibt sich gegenseitig Raum. Das Wort „deutsch“ ist zu einer untergeordneten Herkunftsbezeichnung geworden. Kein Mensch wundert sich mehr über einen Deutschen mit afrikanischen oder asiatischen Zügen.
In der europäischen, also auch der deutschen Gesellschaft herrscht ein breiter Konsens, dass Menschen, die hier leben und arbeiten wollen, das auch tun dürfen, solange sie die Regeln friedlicher Koexistenz achten. Um sie zu unterstützen, wird massiv in Bildung investiert, die alten wie neuen Bürgern das soziokulturelle Alphabet vermittelt und Orientierung schafft.
Ideologischer oder religiöser Terror ist unbekannt, nicht weil es keine verwirrten, gewaltbereiten Geister mehr gäbe, die ihre Mordlust gern mit höheren Zielen adeln. Aber die Gesellschaft spielt das Spiel nicht mehr mit. Man ist sich einig, dass Konflikte im Gespräch geklärt und Ziele ausschließlich friedlich verfolgt werden. Und so sitzen die rechten, linken, islamistischen und sonstigen Gewalttäter in demselben kriminellen Topf, in den sie auch gehören!“
Das sei doch alles völlig unrealistisch, unterbrach mich mein Bekannter. – Nicht unbedingt. Ich wäre der Letzte, einem Idealismus das Wort zu reden, der gegebene Probleme zugunsten schöner Träume ignoriert. Doch was ist Realität anderes als das Ergebnis unseres Handelns von gestern? Und was ist unser Handeln, wenn nicht das Resultat einer noch früheren Überlegung?
Zukunft entwerfen
Zukunft zu entwerfen ist eine verantwortungsvolle Aufgabe: Ich muss mir klar werden, was und wohin genau ich will, und ob ich es auch noch wollen kann, wenn ich die Konsequenzen bedenke, die sich aus meinem Ziel ergeben. Wenn dieses Ziel darüber hinaus nicht nur mich, sondern auch andere betrifft, gilt es, in Dialog zu treten, um unser Wollen gemeinsam zu ergründen.
Leichter gesagt als getan. Gerade angesichts der so genannten Flüchtlingskrise gibt es drängende Fragen, die nach raschen Antworten verlangen. Das sehe ich auch. Dennoch plädiere ich dafür, die Antworten aus der Zukunft zu holen, statt aus der Vergangenheit. Als Menschen, sagt Einstein, neigen wir dazu, unsere Probleme mit demselben Denken lösen zu wollen, durch das diese Probleme überhaupt erst entstanden sind. Das muss nicht so bleiben.
“Wie sieht deine ideale Szene aus für Deutschland im Jahr 2045?”
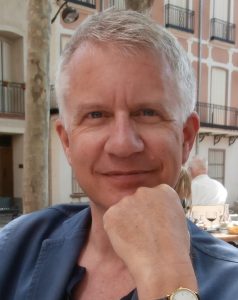
Florian Goldberg ist Germanist und Philosoph, Buch- und Hörspielautor. Er arbeitet seit über 20 Jahren als Bewusstseinstrainer und Coach für Personen aus Wirtschaft, Politik und Kultur. Autor des Buches “Wem gehört dein Leben? – Grundzüge für ein Angewandtes Existentielles Philosophieren”, Kunst Kloster Art Research Verlag 2011 www.florian-goldberg.de
Lesen Sie auch den Beitrag über ein Schulprpojekt von Florian Goldberg








Sehr geehrter Herr Goldberg,
vielen Dank für Ihren wunderbaren und inspirierenden Beitrag!
Herzliche Grüße, Axel Brintzinger