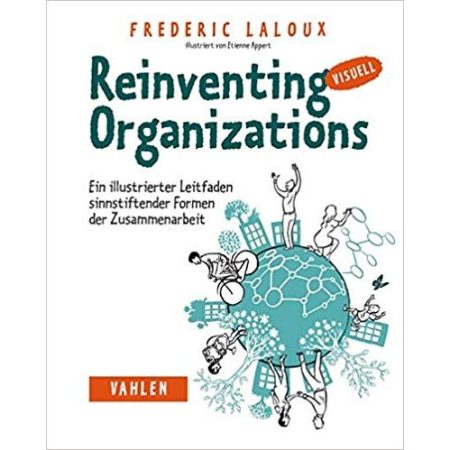Ein Buch über innovatives Arbeiten
Frédéric Laloux hat einen innovativen Ansatz entwickelt, wie Unternehmen und Institutionen in Zukunft organisiert werden können. Statt Hierarchien und Kontrolle geht es um Gemeinschaft, selbstständiges Arbeiten und Dialog. Das stiftet Sinn, und der Erfolg kommt fast von allein.
Der Belgier Frédéric Laloux wurde 2015 mit seinem Buch „Reinventing Organisations“ zu einer zentralen Figur in der internationalen New-Work-Bewegung. Der Reiz dieser stark gekürzten Ausgabe seines Buches liegt in den Illustrationen von Etienne Appert. Auf anschauliche, ja unterhaltsame Weise werden die wichtigsten Ideen evolutionärer Unternehmen vorgestellt. Diese setzen auf Selbstständigkeit, Handlungsfreiheit und Teilhabe an der Gemeinschaft statt auf traditionelle Hierarchien.
Menschen, die eine sinnhafte Beziehung zu ihrer Arbeit und ihrem Team haben, gestalten gerne mit, schreibt Laloux. Und sie sind – auch ohne Führungskräfte – bereit, Verantwortung zu übernehmen. Mit der Selbstführung kommt das Bestreben, dem Ganzen zu dienen bzw. nach „sinnhaften Formen der Zusammenarbeit“ zu suchen. In einem solchen Unternehmen werden Entscheidungen dort getroffen, wo gearbeitet wird oder der Kontakt mit den Kunden stattfindet.
Doch der Weg dorthin ist nicht einfach. Werden Betriebe umstrukturiert, sind nicht alle für Transparenz und Offenheit. Manchmal fehlt die Bereitschaft, Kontrolle abzugeben. Manche Manager fühlen sich fehl am Platz, wenn alle etwas zu sagen haben. Sie entscheiden sich häufig, das Unternehmen zu verlassen.
Von den Menschen, die früher „am Boden der Pyramide“ waren und jetzt mehr mitbestimmen können, geht jedoch kaum jemand. Das Engagement der Mitarbeiter steigt, während Fehlzeiten und Abwanderung abnehmen. Menschen wollen ihre Arbeit frei gestalten.
Lebendige Systeme
Gemeinsinn ist für die Entwicklung von Organisationen, die sich neu erfinden wollen, entscheidend. Die Einsicht dahinter ist, dass die richtigen Ideen sich durchsetzen werden, weil niemand seine Zeit freiwillig für etwas opfert, das keine Aussicht auf Erfolg hat. Auch dieses Management beruht auf klaren Strukturen und Spielregeln, in denen aber die Macht breit verteilt ist.
Ein Beispiel ist der Pflegedienst Buurtzorg. Der Krankenpfleger Jos de Blok gründete das Unternehmen 2007 in den Niederlanden. Hier arbeiten Pflegefachleute in selbstorganisierten Teams. Heute versorgen 14.000 Mitarbeiter etwa die Hälfte der Pflegebedürftigen in den Niederlanden. Buurtzorg hat die höchste Patientenzufriedenheit, die Verwaltungskosten betragen ein Drittel sonstiger Pflegedienste.
Die Philosophien, die in den Unternehmen gelebt werden, unterscheiden sich, denn: „Letztendlich kommt es auf das lebendige System Ihrer Organisation an – und auf Sie in Ihrer Organisation. Wohin will sich das lebendige System – wohin wollen Sie sich – entwickeln und was wollen Sie dafür tun?“
Ohne Strategie- und Budgetpläne
Laloux stellt in seinem Buch zwölf Organisationen vor. Doch keine hat einen Strategieplan für die nächsten drei oder fünf Jahre. Sie lassen die Illusion los, sie hätten Kontrolle über die Zukunft. Sie wechseln zum „Spüren und Antworten“. Anstelle einer Strategie- oder Budgetplanung bauen sie eine evolutionäre Perspektive auf und experimentieren damit.
FAVI beispielsweise stellt technische Teile für verschiedene Branchen, unter anderem für die Automobilindustrie her. Der ehemalige CEO Jean François Zobrist hat die hierarchische Organisation von FAVI aus den 1980er Jahren über Bord geworfen, Freiheit, Vertrauen und Gleichheit haben Einzug gehalten. Für die Zusammenarbeit empfiehlt er einen offenen Dialog:
„Ich schlage vor, dass wir zusammen lernen, mit guten Absichten, gesunden Menschenverstand und Wohlwollen.“ Das hat zur Folge, dass Maschinenbediener die Entscheidung für millionenschwere Neuanschaffungen ihrer Maschinen eigenverantwortlich und erfolgreich treffen können.
Was wollen wir wirklich?
New Work beginnt mit der Frage, was die Beteiligten wirklich tun wollen. Menschen sollen ihre eigene Persönlichkeit mit in die Arbeit einbringen. Sie ist die Grundlage der betrieblichen Entwicklung und Erfolgs. Die Geschäftsführerin oder der CEO braucht eine evolutionäre Weltsicht, die von den Eigentümern geteilt wird.
Große Konzerne haben es schwer, ihre einseitige Leistungsorientierung und das Shareholder Value zu ändern. Daraus schließt Laloux: „Es ist leichter, eine evolutionäre Organisation neu zu gründen als eine bestehende Organisation, die schon eingefahren ist, zu transformieren.“
„Reinventing Organizations visuell“ ist durch die gelungene Kombination von Text und Grafik ein hervorragender Einstieg in Theorie und Praxis der New Work. Es weckt die Zuversicht, dass bald mehr solcher Unternehmen gegründet werden.
Gerald Blomeyer
„Reinventing Organizations. Ein illustrierter Leitfaden sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit“ von Frédéric Laloux mit Illustrationen von Etienne Appert, 171 Seiten, Verlag Vahlen 2017, 25 €
Viele Infos gibt es auf der Website von Laloux: www.reinventingorganizations.com