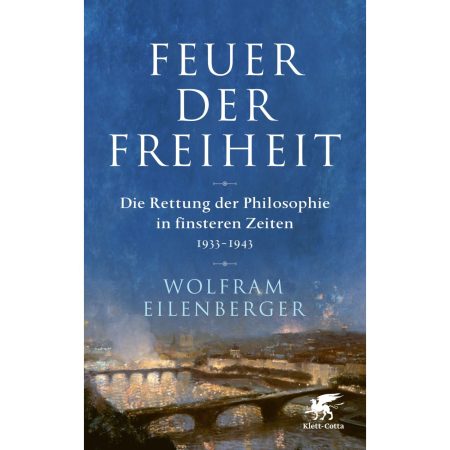Vier starke Frauen im Portrait
Wolfram Eilenberger erzählt von der geistigen Kraft von vier großen Denkerinnen in den 1930er Jahren: Simone Weil, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt und Ayn Rand. So unterschiedlich sie auch sind, so verbindet sie vieles: Sie befinden sich in schwierigen Situationen, sie sind Außenstehende und lassen sich in ihrem Wunsch nach Freiheit nicht beirren.
Die vier Denkerinnen, die in Wolfram Eilenbergers Buch in den Jahren 1933 bis 1943 das „Licht in die Welt trugen“, waren auf ihre je eigene Weise kluge Beobachterinnen des Zeitgeschehens auf der Suche nach Antworten. Eine Suche in wahrhaft dunklen Zeiten, in denen jedes Licht, jedes Feuer notwendig war, auch wenn es den Gang der Geschichte in den 1930er Jahren nicht aufzuhalten vermochte.
Simone Weil, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt und Ayn Rand sind darin nicht nur wortgewaltige Heldinnen, die einen scharfsinnigen Blick auf die gesellschaftliche Not ihrer Zeit werfen konnten. Auch in ihren Lebenswegen und persönlichen Schicksalen zeigen sie, was es bedeutet, sich denkend einer Welt entgegen zu stellen, die sich beständig zum Schlechteren wendet und wenig Raum für Hoffnung lässt
Simone Weil engagiert sich schon in ihrer Studentenzeit als „rote Simone“ für eine sozialistische Revolution in Frankreich. Sie schreibt und lebt gegen die sozialen Ungerechtigkeiten mit einer Radikalität an, die sie auch körperlich immer wieder an die eigenen Grenzen bringen.
Ihr Wille zur Selbstaufopferung ist dabei etwas grundlegend anderes, als das, was Simone de Beauvoir in ihrer existenzialistischen Gemeinschaft mit Jean-Paul Sartre in Paris zu leben versucht. Das Paar wollte sich in einem komplizierten Beziehungsgeflecht aus geistiger und körperlicher Nähe bürgerlichen Traditionen und Moralen entgegen stellen, ohne politisch aktiv zu sein.
Hannah Arendts Weg aus Nazideutschland führt über Paris und dann weiter nach New York. Geistig beginnt er in den philosophischen Gedankenwelten ihrer Lehrer Karl Jaspers und Martin Heidegger. Arendt entwickelt sich zu einer politischen Denkerin. Sie widmet sich den Ursprüngen totalitärer Herrschaft und will das Prinzip des Bösen verstehen. Die Menschlichkeit als humanistisches Grundprinzip eines Denkens in Beziehungen – das ist es, was Hannah Arendts Philosophie kennzeichnet.
Einen ganz anderen Blick auf das, was gesellschaftlich wesentlich ist, hat die Russin Ayn Rand in ihren literarisch ausgerichteten Werken entwickelt. Aus Russland geflohen und ganz auf sich allein gestellt, sieht Rand in der Philosophie Friedrich Nietzsches und der amerikanischen Freiheitsidee, die jedem das Recht auf ein Streben nach Glück und Erfolg zubilligt, das wichtigste Prinzip, um die Gesellschaft von Grund auf zum Besseren zu verändern.
Bei all diesen Unterschieden legt Wolfram Eilenberger fast kunstvoll die Gemeinsamkeiten der vier Denkerinnen in den Wirren des Zweiten Weltkriegs offen: ihre Unsicherheiten, das Warten und das permanente Straucheln an den Umständen, aber auch ihre Versuche, all den Widrigkeiten mit dem eigenen Denken zu begegnen.
Wie ein Geflecht werden ihre Fragen und unterschiedlichen Perspektiven zu einem Bild der Zeit. Immer wieder ist es eine gemeinsame Blickrichtung, die sie eint: Sie denken vom Rand der Gesellschaft aus, als Außenstehende. Wieder und wieder stehen sie vor derselben Frage: „Was mag es letztlich sein, das mich so anders macht?“
Die Welt im Denken ändern
Diese Frage ist auch die Frage nach der eigenen Identität. Wo verläuft die Grenze zwischen mir und den anderen, wohin gehöre ich und warum? Alle vier Frauen erleben ein ähnlich großes Unbehagen an der Welt der anderen. Da ist auch eine große Verunsicherung angesichts dessen, wie Menschen sein können, ja, wie sie sind. Und dennoch geben sie den Versuch nicht auf, „dieses offenbar immer drängendere Unbehagen heilend zur Sprache zu bringen.“
Bei Simone Weil nimmt das Verhältnis zwischen dem „Ich“ und den anderen eine fast religiöse Form der Selbstaufopferung an. Simone de Beauvoir verschreibt sich lange vor ihren Gedanken zur Geschlechteridentität einer Art metaphysischer Solidarität.
Hannah Arendts Einsicht setzt auf die Pluralität der menschlichen Welt und das politische Denken im „Zwischenraum“. Und Ayn Rand verfolgt das Konzept einer Überwindung der Selbstlosigkeit in einer Zuwendung zur radikalen Individualität des Ich.
Das, was die Protagonistinnen eint, ist eine Stärke des Geistes, ein Denken, das nicht aufgibt und danach strebt, die Welt zu verstehen und dadurch letztlich auch zu verändern.
Dabei stellt Wolfram Eilenberger die Unterschiedlichkeiten heraus, ohne sie zu kommentieren. Er verflicht Unterschiedliches, ohne es in eine Hierarchie zu bringen und lässt die LeserInnen sich selbst ein Bild machen.
Eilenberger zeigt sich als genauer Beobachter und lebendiger Erzähler, wenn er die vier Lebensläufe und Denkwege mit einem menschlichen Blick auf die Schwächen, die Schwierigkeiten und Hindernisse beschreibt, die in ihrer Existenzialität für uns heute kaum vorstellbar sind. Und gleichzeitig zeigt er zwischen den Zeilen, wie sehr jede Zeit auf ebensolche denkenden und betrachtenden Menschen angewiesen ist, um das Feuer der Freiheit am Lodern zu halten.
Die Freiheit, die in im Denken aller vier Denkerinnen eine Rolle spielt, liegt in dem beharrlichen Versuch, egal unter welchen Umständen an diesem Verhältnis weiterzudenken und die Konflikte nicht zu scheuen, die solche Gedanken mit sich bringen. Und das macht Wolfram Eilenbergers Buch zu einem Appell für einen tätigen Geist, in dem uns diese vier Frauen als kluge Vorbilder für die eigenen Fragen der Gegenwart dienen können.
Ina Schmidt
Wolfram Eilenberger: Feuer der Freiheit. Die Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten (1933 – 1943). Klett-Cotta, Stuttgart 2020. 400 Seiten, 25 Euro.