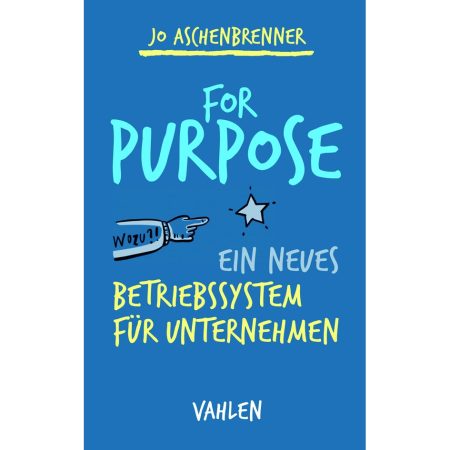Die Holakratie-Praxis
Jo Aschenbrenner stellte in Hamburg ihr Buch „For-Purpose“ vor. Nicht die Gewinnmaximierung soll unternehmerisches Handeln leiten, sondern der Sinn. Dabei setzt sie auf Selbstorganisation nach der Holakratie®-Praxis: Alte Machstrukturen werden durch agile Strukturen ersetzt.
Es ist ein kleiner Kreis von Interessierten, die sich an diesem regnerischen September-Abend in der Hamburger Bucerius Law School versammeln. Thema des Abends ist „Sinn im Unternehmen finden“. Hieße der Titel „Profit maximieren“ oder „Effizienz und Leistung steigern“ hätte man sicher einen großen Saal füllen können.
Doch mit tieferen Fragen die eigene unternehmerische Tätigkeit zu prüfen – das ist heikel und herausfordernder als Bilanzen und Finanzierungspläne zu erstellen: Warum bin ich mit meinem Unternehmen hier? Was will ich wirklich – über das Geldverdienen hinaus?
Die Rechtsanwältin und Autorin Dr. Jo Aschenbrenner, auch Mitarbeiterin des Start-ups encode.org, dessen Gründer Tom Thomison die Buchvorstellung begleitet, macht klar: Angesichts der großen Herausforderungen unserer Zeit kann es kein „Weiter so“ geben. Klimakrise, Ressourcen- und Energieverschwendung, Migration und Ungerechtigkeit – gerade die Wirtschaft müsse einen Beitrag zur Lösung der großen Probleme leisten.
Aschenbrenners und Thomisons Anliegen ist es, Unternehmen und Organisationen auf dem Weg zu Selbstorganisation und zu agilen Strukturen zu unterstützen. „Wir brauchen eine Purpose Economy“, ist Aschenbrenner überzeugt. „Der Sinn muss Basis der täglichen Entscheidungen im Unternehmen sein. Wir brauchen ein anderes Betriebssystem.“ Damit meint sie eine Struktur, die nicht geprägt ist von Bürokratie, Machtkämpfen und Egospielen, sondern von lebendiger, kollegialer Zusammenarbeit, von Eigenverantwortung und Kreativität.
Dynamische Steuerung und Selbstorganisation
Ein Hilfsmittel für den Wandel ist das, was in der New Work-Bewegung als „Holakratie“-Praxis bekannt wird: ein neues System zur Führung und Arbeitsweise von Unternehmen, das die herkömmliche Hierarchie der Pyramide durch das Modell des Holons ersetzt. Ein Holon ist ein Organisationsteil, ein Kreis, der Teil eines anderen Kreises ist. Die Struktur ist ähnlich wie ein menschlicher Organismus, dessen Zellen in Organen enthalten sind und diese im ganzen Körper.
Die unterste Ebene in diesem Modell ist die Rolle, nicht der Mitarbeiter oder eine Funktion. Die Rolle ist Teil eines Kreises, hat einen klaren Auftrag und ist in ihrer Verantwortlichkeit (was wird von der Rolle erwartet) und in ihren Kompetenzen (was darf nur diese Rolle tun) zu anderen Rollen klar abgegrenzt. All das ist für alle sichtbar und transparent.
Das Tagesgeschäft soll in Eigenverantwortung laufen. Entscheidungen fallen nicht in Chefetagen, sondern dort, wo die Kompetenz vorhanden bzw. gearbeitet wird. Kein „Befehl und Gehorsam“, keine Gängelung, keine schwerfälligen bürokratischen Prozesse. Stattdessen dynamische Steuerung, Selbstverantwortung und Selbstorganisation – all das verspricht die Holakratie-Praxis.
Damit es funktioniert, müssen sich alle an bestimmte Regeln halten, die in der Holakratie®-Verfassung niedergelegt sind. Die neuen Spielregeln zeigen Prozesse zur Entscheidungsfindung auf und führen einen operativen Meeting-Prozess ein, damit die Arbeit koordiniert wird.
Es geht um Sinn, nicht um Macht
Was ist das Schwierigste, wenn man das Unternehmen entsprechend verändern will? Tom Thomison, der Implementierungsprozesse in Unternehmen unterschiedlicher Größe begleitet hat, sieht die Schwierigkeiten auf zwei Ebenen: auf der Seite der Führungskräfte und auf der Seite der Mitarbeiter.
Die Managerinnen sowie Bereichs- und Abteilungsleiter müssen alte Macht abgeben, die Teil ihrer Identität war. Wer bin ich, wenn ich keine Führungskraft mehr bin? Sie müssen außerdem wieder „arbeiten“ lernen und gleichzeitig „verlernen“, dass ihre Arbeit das Führen anderer Menschen war.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben keine Vorgesetzten. Sie können ihre eigene Stimme einbringen, ja es ist von ihnen gefordert, sich nicht hinter einer Chefin zu verstecken. Sie sollen Verantwortung übernehmen und am Unternehmen partizipieren. Diese Freiheit kann den Einzelnen überfordern.
Und wie bringt man ein Unternehmen dazu, nach den neuen Prinzipien zu arbeiten? „Es ist die letzte Top Down-Entscheidung, die die Manager fällen, nämlich dass sie ihre konventionelle Macht abgeben“, sagt Thomison. Dies tun sie, indem sie die Holakratie-Verfassung unterzeichnen. Sobald der Weg beginnt, gibt es keine Hierarchie von oben nach unten mehr.
Alle Mitarbeiter können Gesellschafter sein
In Deutschland sind Unternehmen, die nach der Holakratie-Praxis arbeiten, zum Beispiel das Berliner Startup Soulbottles, der Finanzdienstleister Hypoport oder die Salesforce-Beratungsfirma Empaua.
Ein Problem auf dem Weg zur Selbstorganisation, ist die rechtliche Seite – dieser gilt das besondere Augenmerk der Rechtsanwältin Jo Aschenbrenner. Im deutschem Unternehmensrecht findet sich die alte Hierarchie wieder: (Mehrheits-) Eigentümer können den Kurs des Unternehmens bestimmen und der Geschäftsführung Weisungen erteilen. Die Geschäftsführung muss den Shareholder Value steigern und sagt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wo es langgeht, um dieses Ziel zu erreichen. Sie verdient ein Vielfaches der Angestellten.
Als Rechtfertigung für den höheren Verdienst einer Geschäftsführerin wird häufig die Haftung angeführt, die sich aus den rechtlichen Strukturen ergibt. Und da die Eigentümer tragen das unternehmerische Risiko und müssten auch sie mehr am Erfolg profitieren.
In einer Organisation, die nicht hierarchisch organisiert ist, können Einzelne jedoch nicht über die Ausrichtung des Unternehmens bestimmen. encode.org hat ein Modell entwickelt, bei dem alle Mitarbeitenden Gesellschafter sind und es keinen Angestelltenstatus mehr gibt.
Was ist eigentlich sinnvoll?
Das Thema Sinn im Unternehmen wirft viele Frage auf. Kann es sinnvoll sein, Pestizide herzustellen oder Flugzeuge zu bauen? Aschenbrenner stellt klar: „Was unter Sinn verstanden wird, muss jedes Unternehmen für sich bestimmen. Die Holakratie ist bewusst neutral“.
Und das ist konsequent, denn ein Unternehmen gehört nach dieser Lesart nur sich selbst. Keine Gründerfamilie und auch keine noch so kluge Beraterin kann entscheiden, was der Sinn des Unternehmens ist. Das widerspräche dem Prinzip der Selbstorganisation.
 Vielmehr geht es darum, in einem definierten Prozess den Sinn des Unternehmens herauszufinden. Thomison ist überzeugt, dass ein Unternehmen mit einem „guten“ Sinn, der mehr am Gemeinwohl orientiert ist, auch die besseren Talente anziehen wird. Andersherum: Ein Unternehmen, das nur auf Profit aus ist, wird vermutlich gar nicht erst diese Art von Change anstreben.
Vielmehr geht es darum, in einem definierten Prozess den Sinn des Unternehmens herauszufinden. Thomison ist überzeugt, dass ein Unternehmen mit einem „guten“ Sinn, der mehr am Gemeinwohl orientiert ist, auch die besseren Talente anziehen wird. Andersherum: Ein Unternehmen, das nur auf Profit aus ist, wird vermutlich gar nicht erst diese Art von Change anstreben.
„Ich habe gelernt, Kontrolle bewusst loszulassen“, fügt Aschenbrenner hinzu. „Ich habe mich auf den Sinn von encode.org eingelassen und auch darauf, meinen eigenen Sinn zu finden. Wenn man erst einmal in diesen Prozess einsteigt, verändert sich die Sicht auf das, was wirklich wichtig ist. Man muss Vertrauen haben.“
Ein Schlüsselsatz an diesem Abend. Denn eine Organisation oder Firma wird als lebendiges System betrachtet, eine Art Ökosystem, in dem unablässig Neues entsteht. Man muss lediglich klare Bedingungen und Regeln schaffen, damit sich alles gut entfalten kann. Und die Illusion aufgeben, man könne in komplexer Welt das Geschehen hin zu konkreten Ergebnissen oder Zahlen steuern.
Birgit Stratmann
Jo Aschenbrenner,For Purpose. Ein neues Betriebssystem für Unternehmen, Verlag Franz Vahlen, München, 2019, 170 Seiten, kartoniert, € 24,90
Lesen Sie auch das Interview mit Dennis Wittrock von encode.org “Wir können die Wirtschaft transformieren”
https://www.for-purpose.de/ueber-mich/
https://www.holacracy.org/