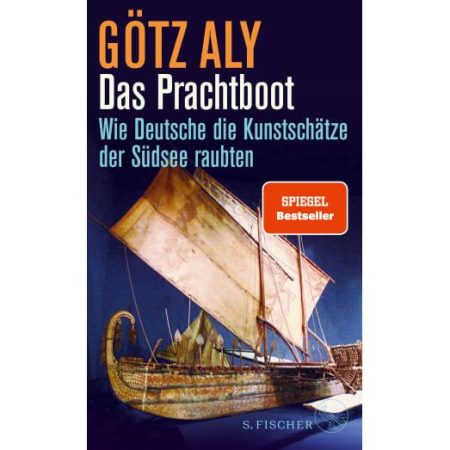Buch über ein Boot im Humbolt Forum
2020 öffnete das Berliner Humboldt Forum. Die ethnologische Sammlung zeigt auch Objekte aus ehemaligen deutschen Kolonien. Götz Aly hat die Geschichte des „Prachtboots“ recherchiert, das im Foyer gezeigt wird. Das Buch soll für koloniale Raubkunst sensibilisieren, auch uns Museumsbesucher.
Als Junge habe ich mich sehr für Tiere interessiert, wollte Zoologe werden und bin in jeden Zoo gerannt, den ich erreichen konnte. Alle Tiere haben mein Interesse geweckt, natürlich am meisten die Tiger und die Löwen. Damals wusste ich noch nicht, dass ein sibirischer Tiger ein Revier von ca. 1000 Quadratkilometern braucht und verteidigt.
Später wurde mir klar, dass ein Tiger im Zoo eigentlich kein Tiger ist, weil er kein nennenswertes Revier mehr um sich hat. Heute besuche ich keine Zoos mehr, denn ich sehe nicht mehr die Tiere, sondern die Käfige.
Mit Kunstwerken aus fernen Ländern geht es mir genau so: Als Berliner habe ich oft die wunderbare Nofretete besucht, aber mich auch gefragt: Ist es richtig, dass sie in Berlin ist ? Wie kam sie da hin?
Dieser Frage geht Götz Aly in seinem Buch „Das Prachtboot“ nach. Es bezieht sich auf das sogenannte Luf-Boot, im Foyer des neuen Humbolt Forums Berlin zu bestaunen. Aly erzählt die Geschichte der „Umsiedlung“ (so nennen es die Verteidiger des Eigentumsanspruchs) so detailliert, dass man nur staunen kann, wie er diese Quellen aufspüren konnte.
Mindestens genau so erstaunlich ist, dass die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die über die meisten dieser Quellen verfügt, diese Untersuchung nicht schon längst durchgeführt hat. Die Stiftung ist offenbar mehr an dem Objekt selbst interessiert als an der Aufarbeitung seiner Provenienz. Dankenswerterweise liefert Aly dies nun nach.
Grausamer Kolonialismus
In seinem Buch rollt er die ganze furchtbare Geschichte des deutschen Südseekolonialismus auf – und zwar auf andere Weise. Denn oft wurde die Forschung verbrämt unter dem Deckmantel ethnologischer Studien.
Den Völkerkundlern ging es um die „Rettung und Erhaltung“ von Kunstwerken, die von ihren Schöpfern verkauft, vernachlässigt oder vergessen wurden. Warum? Weil deutsche Kolonialisten sie versklavt, vertrieben oder ermordet hatten.
So wurden die Bewohner der Insel Luf 1882/83 mit einer Strafaktion „gezüchtigt“. Dabei kamen 700 von ca. 800 Menschen ums Leben. Die verbliebenen 100 bauten das Schiff, aber konnten es nicht mehr benutzen, weil ihnen die nautischen Fähigkeiten abhanden gekommen waren.
Die Strafaktion, die damals in deutschen Zeitungen groß gefeiert wurde, war ein Racheakt. Die Bewohner hatten offenbar zwei Jahre vorher zwei deutsche Siedler ermordet. Diese hatten den Dschungel abholzen lassen, damit sie eine Kokosplantage betreiben konnten, auf der die Ureinwohner arbeiten mussten. Das geschah zur „Erziehung“ der Bewohner, „die das Arbeiten ablehnten“. Bei der solchen Strafaktion wurden die Häuser und Boote gezielt zerstört, die die Lebensgrundlage der Fischer bildeten.
Kunstgegenstände nach Deutschland geschafft
Aly berichtet in seinem Buch nicht nur von der Inbesitznahme des Luf-Bootes, sondern auch von der Erwerbspolitik des deutschen Völkerkundemuseums, das nicht nur in der Südsee, sondern in allen kolonialen „Besitzungen“ eine expansive Erwerbspolitik betrieb.
Es scheint eine regelrechte Panik ausgebrochen zu sein, koloniale Kunstgegenstände nach Deutschland zu schaffen, „bevor nichts mehr da ist“. Die Befürchtungen waren nicht unbegründet, denn es gab viel Konkurrenz vor allem von Großbritannien, das ebenso rigide beim Erwerb von Kulturgut vorging wie Deutschland und wesentlich mächtiger.
Zum anderen war Eile geboten, da die Befürchtung bestand, die Ureinwohner könnten alsbald aussterben, was angesichts der grausamen Behandlung, der sie ausgesetzt waren, auch wahrscheinlich war.
Unter diesen Umständen den legalen Erwerb des Bootes hervorzuheben, wie es die Historikerin Brigitta Hauser-Schäublin in der ZEIT (29/2021) versucht, ist lächerlich und ruchlos. Zwar wurde das Boot 1904 dem Völkerkundemuseum in Berlin verkauft, doch wie der ursprüngliche Erwerber Max Thiel selbst in seinen Besitz kam, ist nicht überliefert.
Thiel schreibt: „Es fiel mir in die Hände.“ Frau Hauser-Schäublin mahnt: „Aber gerade weil schriftliche Zeugnisse über den Erwerb dieses Bootes fehlen, bedürfen die Erwerbsumstände einer differenzierten Annäherung und die Schlussfolgerungen Alys einer Überprüfung.“ Warum diese „Erwerbsumstände“ seit 1904 nicht geleistet wurden, verschweigt die Wissenschaftlerin. Abgesehen davon ist die Argumentation widersprüchlich: Solange die „Erwerbsumstände“ nicht klar sind, dürfte das Humboldtforum auch keinen Eigentumsanspruch erheben.
Auch wenn gezeigt werden könnte, dass das Boot von Thiel legal erworben wurde, zum Beispiel durch Bezahlung mit Kautabak der Marke „Niggerhead“, auch in diesem unwahrscheinlichen Fall, denn warum hätte Thiel diesen Umstand verschweigen sollen, wäre der Erwerb nicht zu rechtfertigen.
Es gibt keinen fairen Handel unter solchen Bedingungen. Somit sind die Rechtfertigungsversuche heutiger Verteidiger wie von Kulturstaatsministerin Monika Grütters oder dem Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Hermann Parzinger zum Scheitern verurteilt.
Umstände des Erwerbs deutlich machen
Götz Alys Verdienst ist es ohne Zweifel, die Umstände des Erwerbs von Kulturgütern aus den deutschen Kolonien akribisch dargestellt zu haben. Gleichwohl plädiert er nicht für einen Automatismus der Rückgabe. Seine Position ist differenziert:
Es komme darauf an, ob die Nachfolger der Herkunftsgesellschaft, für das Luf-Boot der Staat Papua-Neuguinea, die Rückgabe verlangen. Das ist hier nicht der Fall. Er fordert allerdings, dass die Umstände des Erwerbs deutlich und die Quellen, derer er sich als Historiker bedienen konnte, allgemein zugänglich gemacht werden.
Denn auch dies gehört inzwischen zur Geschichte des Bootes. Eine weitere Konsequenz wäre der Verzicht auf den „Eigentumsanspruch“ des Museums, der moralisch ohnehin nicht vertretbar ist. Die Stiftung sollte sich bis zur Restitution des Bootes als Treuhänderin verstehen.
Solang das Boot in Berlin steht, sollte man sich dieses Wunderwerk unbedingt ansehen: Ein hochseetüchtiges Schiff, mit einfachsten Werkzeugen, ohne einen einzigen Nagel hergestellt.
Für uns Museumsgänger ist es aber auch wichtig, mehr darüber in Erfahrung zu bringen, woher die Ausstellungsstücke kommen, welche Geschichte damit verknüpft ist und wie sie zu uns kamen. Das Buch von Götz Aly hilft uns an einem Beispiel, die Geschichte zu verstehen und sensibilisiert für das Thema Kunstraub.
Carsten Petersen
Götz Aly. Das Prachtboot: Wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten. Fischer Verlag 2021