Ein Interview mit Stefan Bergheim
„Wir denken Zukunft oft von der Vergangenheit her“, sagt Stefan Bergheim. Er moderiert „Zukünftelabore“ also Prozesse, in denen sich Menschen gemeinsam mit Zukunft auseinandersetzen. Denn nur wenn das geschieht, kann man Zukunft gestalten und Neues entwickeln.
Das Gespräch führte Birgit Stratmann
Frage: Sie haben ein Buch geschrieben „Zukünfte – offen für Vielfalt“ und moderieren „Zukünftelabore“. Was ist Ihr Anliegen?
Bergheim: Das Ziel ist, Menschen ins Gespräch über Zukunftsthemen zu bringen. Wir denken ja ständig über Zukünftiges nach, tun dies aber nicht immer gut strukturiert und gemeinsam. In den Zukunftslaboren forschen wir gemeinsam in einer Gruppe, sei es in einer Organisation, einem Unternehmen, einer Stadt, einem Land.
In den Zukünftelaboren sollen neue Ideen auf den Weg gebracht werden – der Prozess hat vier Phasen. In der ersten Phase arbeiten wird mit zwei Fragen: Was wünschen wir uns, z.B. im Themenfeld Arbeit? Was glauben die Teilnehmenden, wie die Zukunft wahrscheinlich aussieht?
In der zweiten Phase laden wir dazu ein, mit einer alternativen Zukunft auseinander zu setzen. Wir trainieren unsere Vorstellungskraft und denken über andere Zukünfte nach.
Wir starten ein Gedankenexperiment, zum Beispiel: Wie schaut eine Zukunft aus, in der es kein Geld gibt, dafür aber eine gestiegene Wahrnehmungsfähigkeit: Die Menschen sind in der Lage, die Wünsche und Bedürfnisse aller anderen Lebewesen wahrzunehmen. Dann die Einladung: Seid kreativ, schmückt das zukünfige Leben einmal zur Übung aus.
In der dritten Phase geht es wieder in die Gegenwart: Was haben wir aus dem Abgleich von Prognosen, Wünschen und Alternativen gelernt, welche neuen Fragen sind entstanden? Dieser Prozess ist spannend und völlig unvorhersehbar. Auch ich als Moderator weiß nicht, wohin die Reise geht – wüsste ich das schon vorher, könnte nichts Neues entstehen. Wir wollen ja etwas herausfinden, für das wir vielleicht noch nicht einmal Worte haben.
In der vierten Phase geht es an die die Umsetzung: Was machen wir mit dem, was wir erarbeitet haben? Welche Allianzen, Arbeitsgruppen schmieden wir, um diesen Fragen nachzugehen?
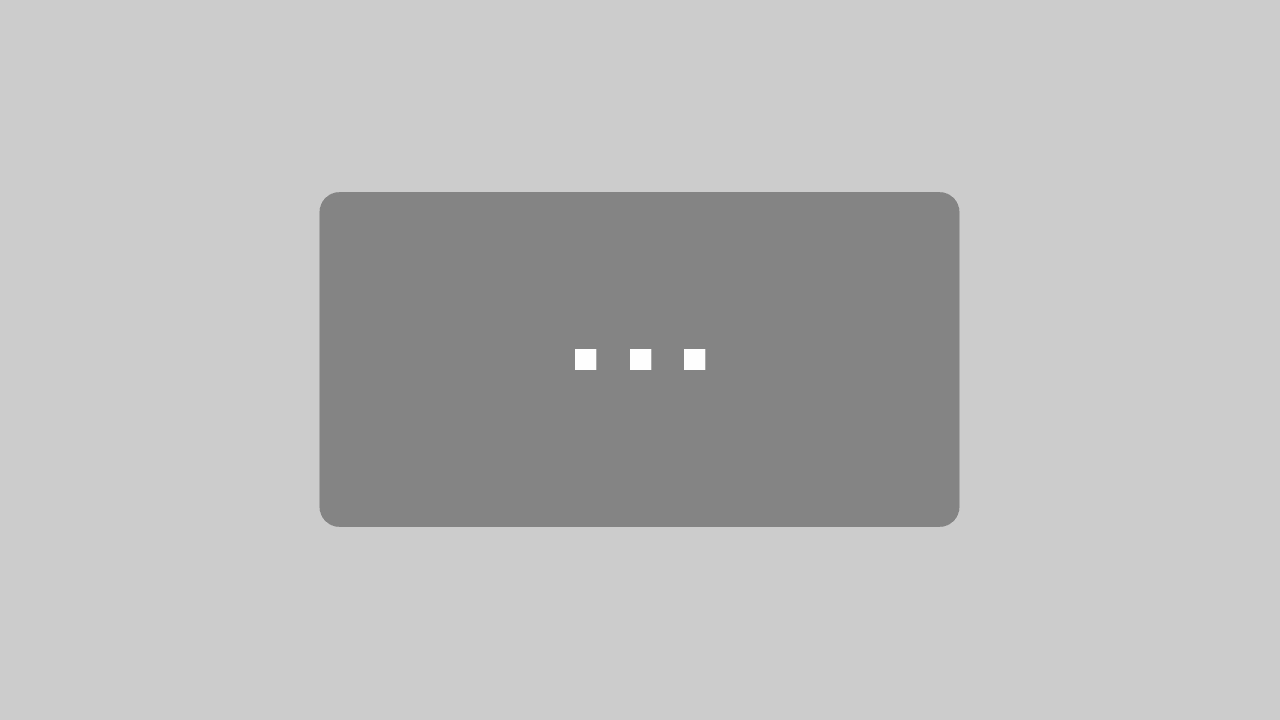
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Unsere Ideen kommen oft aus der Vergangenheit.
Welche Relevanz hat das Thema durch die Corona-Krise bekommen? Gibt es nicht eher die Sehnsucht, dass alles wieder so wird wie früher?
Bergheim: Die Sehnsucht, dass alles wird wie früher, gab es schon vor Corona. Die Pandemie macht sichtbar, dass Zukunft anders passiert, als wir es uns gewünscht oder geplant haben.
Viele sehen jetzt, dass es gut ist, sich strukturiert mit Zukunftsthemen zu befassen, weil sie nur dann gestalten können. Es ist nicht gut, Zukunft einfach auf sich zukommen zu lassen.
In der Politik spielen Zukunftsthemen selten eine Rolle – wenn, dann geht es eher um technische Entwicklungen, z.B. Digitalisierung. Woran könnte das liegen?
Bergheim: Politiker arbeiten viel mit Prognosen. Allerdings sind Prognosen nicht verlässlich, es gibt so viele Unbekannte. Hier würde ich mir mehr Ehrlichkeit wünschen.
Der andere Weg, sich auf die Zukunft einzustellen, ist, eine Zukunft zu entwerfen: eine Vision zu entwickeln und sich zu überlegen, was wünschenswert wäre. Das machen Parteien in ihren Wahlprogrammen, allerdings nur im Rahmen ihrer eigenen Gruppe. Sie werben dann für ihre Zukunftsentwürfe.
Aber die Ideen sind doch meistens von der Vergangenheit abgeleitet.
Bergheim: Genau, die Ideen kommen oft aus der Vergangenheit, und das ist das Problem! Wir müssten fragen: Wo kommen eigentlich unsere Vorstellungen von Zukunft her? Was sind die Quellen unserer Annahmen, Wünsche, Werte? Oft liegen diese in der Vergangenheit. Der erste Schritt wäre, sich das überhaupt bewusst zu machen.
Wir sind da teilweise festgefahren. Neulich haben wir in einem Bildungs-Workshop die Frage aufgeworfen: Wie könnte Bildung ohne Schulen aussehen? Nur als Übung. Die Teilnehmenden waren ziemlich verdutzt. Aber dann haben wir überlegt, wie es vor 200 Jahren war: Für die damaligen Menschen wäre so etwas wie Schulen undenkbar gewesen.
Wir sollten uns bewusst sein: Schulen, Staaten, Wirtschaft – das alles sind von Menschen gemachte Strukturen, die man hinterfragen kann. Das sind große Beispiele, aber ich kann das auf jede Ebene des Lebens herunterbrechen. Hier ist Offenheit wichtig und den Horizont für Alternativen aufzumachen.
Auf das Neue kommt man vermutlich nur gemeinsam und nicht, wenn man in seinem eigenen Saft schmort. Wenn ich Ihren Denkimpuls „Bildung ohne Schule“ nehme – das würde einem Bildungsminister wahrscheinlich nicht als erstes einfallen.
Bergheim: Ja, dadurch, dass wir mit anderen sprechen, werden andere Perspektiven aufgemacht.
Muss man dann nicht die Kontrolle loslassen? Man weiß ja nicht, was am Ende dabei herauskommt.
Bergheim: Es ist sinnvoll, zumindest zeitweise die Kontrolle über die Inhalte loszulassen, wobei der Prozess trotzdem eine Struktur haben sollte. Ich denke beispielsweise an den Zukunftsdialog 2011 und 2012, zu dem die Bundeskanzlerin eingeladen hatte.
Wir haben in verschiedenen Arbeitsgruppen Handlungsempfehlungen an die Bundesregierung entwickelt und waren inhaltlich im Rahmen unseres Themas völlig frei. Allerdings war auch klar, dass nicht alles, was wir empfohlen haben, umgesetzt werden kann. Es gibt das Kabinett, das Parlament, die Länderebene usw. – somit gibt es Einschränkungen, was die Machbarkeit betrifft.
Dialog ist der einzige Weg, die Gesellschaft zusammenzuhalten.
„Gut leben in Deutschland“ war die Folgeveranstaltung, die Sie wissenschaftlich mitbegleitet haben. Im Zentrum standen Bürger-Dialoge zum Thema Lebensqualität. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Bergheim: Die Bundesregierung hat mit vielen verschiedenen Bürgerinnen und Bürgern darüber gesprochen, was ihnen im Leben wichtig ist, was für sie Lebensqualität ausmacht. Daraus wurden dann Indikatoren für die verschiedenen Bereiche abgeleitet. Dazu gibt es übrigens eine hervorragende Website.
Können solche Dialoge das Vertrauen in die Politik stärken? Oder ist es frustrierend, wenn dann hinterher wenig umgesetzt wird?
Bergheim: Menschen wollen gesehen und gehört werden, mitreden. Klar ist aber auch, dass die Politik nicht für alles verantwortlich ist. Zum Beispiel kam oft der Wunsch auf, die gute Nachbarschaft zu pflegen. Hier müssen die Menschen natürlich selbst aktiv werden.
Ich höre heraus, dass Sie für mehr Bürgerbeteiligung sind. Viele Menschen sind politikverdrossen, und Populisten nutzen das aus. Glauben Sie, dass man die Demokratie durch breit angelegte Dialoge stärken kann?
Bergheim: Ja ganz bestimmt. Dialog ist der einzige Weg, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Durch gemeinsamen Austausch wächst das Verständnis für den anderen.
Man muss nicht das ganze Spektrum in einen Raum bringen, aber mehr Perspektiven als normalerweise, damit wir nicht in unseren Blasen hängen bleiben. Dafür braucht es Gastgeber, die so etwas ermöglichen: einen Raum schaffen, mit einer guten Moderation, die so einen Gesprächsprozess strukturiert und begleitet.
Die Gastgeber sollten dorthin gehen, wo die Menschen sind. Es bringt wenig, wenn sie nur in die Stadthalle einladen und dann kommen immer die „üblichen Verdächtigen“. Wir sollten in die Stadtteile gehen, ich nenne es „die aufsuchende Beteiligung“.
Im Forum für Frankfurt etwa sind wir in die nicht so zentralen Stadtteile gegangen, zu den nicht so oft gehörten Stimmen. Da gibt es Jugendclubs, Kulturvereine, Migrantenorganisationen, Initiativen für Straßenkinder. Wir haben sie eingeladen, mit uns über die Zukunft von Frankfurt zu sprechen. Das waren für alle Beteiligten tolle Erfahrungen.
Wir haben über Prozesse in Unternehmen oder Organisationen gesprochen. Wäre es auch sinnvoll, privat auf Visionssuche zu gehen?
Bergheim: Ja unbedingt, vor allem ist es gut, mit alternativen Zukunftsentwürfen zu experimentieren. Das bedeutet zu hinterfragen: Warum mache ich bestimmte Dinge eigentlich? Welche Annahmen über andere, über mich selbst stecken dahinter? Wie könnte eine alternative Annahme aussehen? So erfährt man viel über sich selbst und kann die eigene Zukunft mitgestalten.

Dr. Stefan Bergheim moderiert Zukünftlabore für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Die Regierungsstrategie „Gut leben in Deutschland“ hat er im wissenschaftlichen Beirat begleitet, andere Prozesse wie #gutlebendigital oder „Schöne Aussichten– Forum für Frankfurt“ selbst geleitet. International ist er im Zukünfte-Netzwerk der UNESCO eingebunden, zum Beispiel als Kurator des Zukünfte-Forums 2019 und im Zukünfte-Gipfel 2020. Autor des Buches: ukünfte. Offen für Vielfalt. ZGF Verlag 2020. Kontakt: stefan.bergheim@zukünfte.org






