Der Film „Auf dem Weg – 1300 km zu mir“
Der Schriftsteller Sylvain Tesson überlebt einen schweren Unfall. Statt in die Reha zu gehen, begibt er sich trotz Verletzungen auf eine dreimonatige Wanderung. Der Film zeichnet nach, wie er 1300 Kilometer zurücklegt, um zu sich selbst und wieder ins Leben zu finden. Eine Ode an das freie Unterwegssein. Kinostart: 30. November 2023
„Auf dem Weg“ ist ein Film über das Gehen. Das Gehen als Zugang zu sich selbst, als Flucht vor einer lauten, chaotischen Welt. Gehen als Meditation und Grenzüberschreitung. Als Entschleunigung und Öffnung der Aufmerksamkeit.
Die Geschichte des Films ist inspiriert von einem großen Gehenden, dem französischen Reiseschriftsteller Sylvain Tesson, der im Himalaya, in Sibirien, in Indien oder den Steppen Zentralasiens unterwegs war.
2014 erlitt Tesson einen Unfall, er stürzte acht Meter von einem Balkon und hätte beinahe nicht überlebt. Für den Weltwanderer wurde dieser Einbruch in sein Leben zu einem neuen Aufbruch.
Statt in eine Rehaklinik zu gehen, entschließt er sich zu einer Wanderung durch das ländliche Frankreich. 1300 Kilometer von der Provence bis an die nördliche Küste der Normandie, drei Monate lang. Die Erfahrungen fasste er in das Buch „Auf versunkenen Wegen“, das für den Filmemacher Denis Imbert zur Vorlage des Films dient.
Im Film spielt Jean Dujardin den erfolgreichen Schriftsteller Pierre. Nach seinem Sturz wandert Pierre durch majestätische Natur, die der Film in Szene setzt, ohne sie lediglich zur Dekoration zu machen. Selbst in unserer heutigen Zeit gibt es sie, die kaum begangenen Pfade.
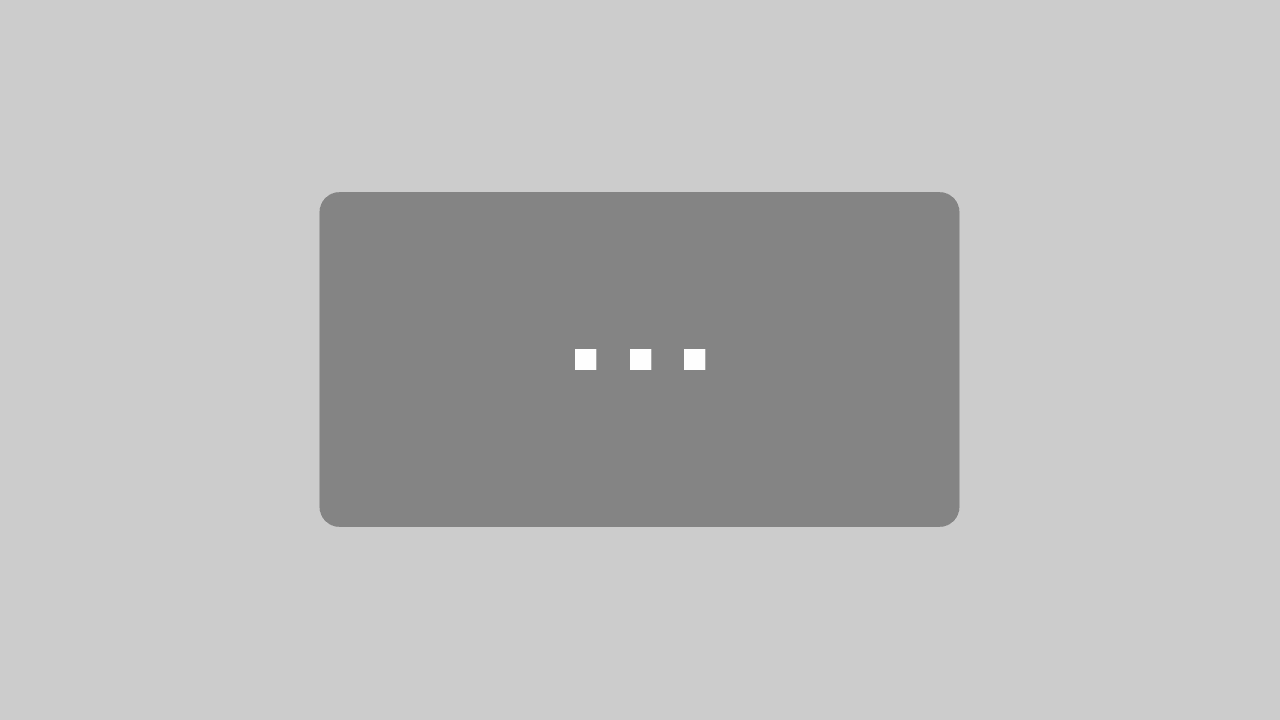
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Selbsttortur oder tiefere Selbsterkenntnis?
„Die verborgenen Wege zu nehmen, nach Lichtungen zu suchen hinter Brombeerhecken war die einzige Möglichkeit, der Maschinerie der Stadt und der Gefangenschaft toter Bildschirme zu entkommen“, schreibt Pierre in sein Notizheft, das ihn begleitet.

Durch die gesprochenen Einträge lässt er uns teilhaben an seinem inneren Ringen mit der scheinbaren Unmöglichkeit seines Unterfangens, mit einem verletzten Körper tage- und wochenlang zu gehen. Manchmal ist es unsicher, ob es eine Selbsttortur ist oder eine physische Grenzüberschreitung, die tiefer zu sich selbst führt.
Für Pierre wird der Weg zu einer Reflexion über vergangene Erlebnisse. Zahlreiche Rückblenden verbinden uns mit seinem bisherigen Leben, dem er auf diesem Weg entkommen will. Im Verlauf des Films hat man das Gefühl, dass Pierre durch das ständige Weitergehen, die Konfrontation mit der wilden Natur, das Übernachten unter freiem Himmel zu sich findet, innerlich stiller und geklärter wird.
Dabei hätte ich mir etwas mehr Einblick in die Innenwelt von Pierre gewünscht. Die Figur bleibt trotz der Notizen, die Pierre mit dem Zuschauer teilt, wortkarg und man muss seine innere Gestimmtheit an seiner Gestik und Mimik ablesen. Dafür ist der Oscar-Preisträger Jean Dujardin wiederum eine hervorragende Besetzung.
Flucht in die Wildheit
Als Pierre nach seinem Unfall merkt, dass ihm der Rollstuhl erspart bleibt, resümiert er: „Das Wichtigste hatte ich zurückbekommen: Das Recht, abzuhauen und die Braut zu erobern, die einen nie enttäuscht: die Freiheit.“
Der Film porträtiert seine Flucht, weg von einem Leben, in das er sich verstrickt hat, und hin zu einer Seinsweise, die unmittelbarer, schlichter, wilder ist. Eine Flucht aus der modernen Zivilisation, die alles verfügbar macht und das Wilde überall zähmen möchte.
Der Aufbruch ist ansteckend und eine Ode an das wandernde, das vagabundierende, das freie Unterwegssein. Gleichzeitig lässt es die Frage aufkommen, ob wir uns in unserer krisenhaften Zeit den Luxus der Flucht aus der Gegenwart leisten können.
Die Langsamkeit lässt die Aufmerksamkeit weiten
Für Pierre ist solch ein Aufbruch aber der lebensrettende und selbstklärende Neubeginn. Und der Film zeigt, dass es immer möglich ist, eine Form unseres Lebens, die nicht mehr stimmig ist, zu verlassen, um einen neuen Horizont zu eröffnen. Und dass es in unserer Welt verborgene Orte und versunkende Pfade gibt, die es immer noch zu entdecken gilt.
Dabei ist das Gehen auch ein Aufbegehren gegen den Takt einer schnelllebigen Welt. Selbst im Film kann man spüren, wie sich eine Langsamkeit einstellt, die die Aufmerksamkeit weitet und uns das Leben im eigentlichen Glanz erkennen lässt.
Im Film erleben wir, wie Piere mehr und mehr vom Gehen geformt wird. „Auf dem Weg“ bietet die Gelegenheit, der Seinsform des Gehens nachzuspüren und macht Lust, sich selbst auf den Weg zu machen.
Ganz konkret im Wandern durch die unentdeckte Welt, und auch im übertragenen Sinne als die Bewegung in neue Möglichkeiten des eigenen Lebens. Oder wie es Pierre im Film ausdrückt: „Aufbruch bedeutet, eine Bresche in die Mauer zu schlagen.“
Mike Kauschke







