Philosophisches Basiswissen: Aristoteles
Der griechische Philosoph Aristotels entwirft in seiner Tugendethik keine Regeln, was zu tun und zu lassen wäre. Vielmehr geht es ihm um die Haltungen, die dem Handeln zugrunde liegen. Sind diese tugendhaft und vernünftig, stellt sich Glück von allein ein. Der Philosoph Andreas Luckner über eine Ethik, die die Lebensklugkeit in den Mittelpunkt stellt.
„Es gibt nichts Gutes außer man tut es“ – dieser knackige Spruch stammt zwar von Erich Kästner, er ließe sich aber zwanglos auch als Motto der Ethik des Aristoteles (384 bis 322 v. Chr.) überschreiben.
Nicht die Idee des Guten überhaupt hat den jahrzehntelangen Schüler Platons vornehmlich interessiert, sondern „das für den Menschen Gute“. Man könnte dies als das bezeichnen, was in den alltäglichen Situationen hier und jetzt für uns erreichbar ist, eine Sache, die gerade heute bekanntlich hoch im Kurs steht.
Für eine solche im wahrsten Sinne des Wortes „praktische“ Philosophie – die nämlich praktisch tauglich und wirksam ist – hat Aristoteles systematisch entscheidend und heute mehr denn je Wichtiges entwickelt. Genannt seien hier nur sein Konzept von eudaimonia bzw. dem gelungenem Leben, seine Unterscheidung von Tätigkeitsformen (praxis und poiesis) und seine Auffassung von Tugenden (aretai) als festen, erworbenen Grundhaltungen, die Orientierung stiften und zum Handeln motivieren. Nicht zuletzt gehört dazu sein Begriff der Klugheit (phrónêsis), der zentralen intellektuellen Tugend, durch die eine Person erfahrungsbasiert Entscheidungen zum Handeln situationsgerecht zu treffen und umzusetzen vermag.
Tugendethik: Gute Grundhaltungen kultivieren
Die Position, die Aristoteles im vierten vorchristlichen Jahrhundert erstmalig in systematischer Form bezieht, nennt man heutzutage gerne „Tugendethik“. Gerade heutzutage erfährt die Tugendethik in der akademischen Debatte eine breite Renaissance und zählt wieder zu einer wichtigen Position im Spektrum der Ethik.
Sie wird oft etwas irreführend mit der Moralphilosophie in ihren verschiedenen Varianten (wie etwa der Deontologie, die auf Kant zurückgeht oder dem Utilitarismus) auf eine Ebene gestellt. Es war aber nicht das Anliegen von Aristoteles – wie generell der Tugendethik – zu klären oder zu begründen, was einem zu tun geboten oder verboten ist. Vielmehr geht es darum, welche Handlungsmotive zu kultivieren zu einem glücklichen Leben führen, bei dem freilich auch die moralischen Gesichtspunkte eine wichtige Rolle spielen, aber nicht im Vordergrund stehen.
Ein tugendhafter Mensch wird die unbedingten moralischen Erfordernisse von alleine abdecken. Tugenden sind dabei durch Gewöhnung bzw. Einübung in einem Erziehungs- bzw. Sozialisationsprozess herausgebildeten feste Grundhaltungen bzw. Charaktereigenschaften, aufgrund derer z. B. moralisch schlechte Handlungsmotive gar nicht erst in die Optionstüte kommen können.
Worin besteht nun nach Aristoteles ein gutes, gelungenes und damit glückliches Leben (griech. eudaimonia) genau? Zunächst: Wir Menschen zeichnen uns vor anderen Lebewesen wesentlich dadurch aus, dass wir unser Handeln und Leben vernünftig einrichten können. Dadurch wird das für den Menschen Gute, die eudaimonia darin bestehen (oder doch zumindest etwas damit zu tun haben), dass wir diese Steuerungsmöglichkeit möglichst gut, ja in ihrer Bestform auszuüben in der Lage sind.
Ein gutes, d. h. glückliches Menschenleben bestünde daher nicht in dem Erreichen eines möglichst anhaltenden Zustandes maximalen Wohlbefindens, was gewöhnlich unter „Glück“ verstanden wird. Die Lust und Lebensfreude (griech. hedonê), die im Prinzip auch andere Lebewesen empfinden können, ist nur das Symptom eines glücklichen Lebens, nicht eigentlich das Ziel. Das Glück, so Aristoteles, geht mit der Freude einher, aber sie macht das Glück nicht aus, wie die Hedonisten sagen, die hierbei sozusagen Ursache und Wirkung verwechseln.
Es geht um Lebensklugheit
Das glückliche Leben ist vielmehr die „Tätigkeit der Seele gemäß (ihrer) Tugend“ (NE 1098a18). Diese Tugend, die Bestform, dergemäß die Seele bzw. die Person tätig ist, bestimmt Aristoteles letztlich als die phrónêsis, die praktische Vernünftigkeit oder kurz: Klugheit. Ein glückliches Leben ist daher ein von der Klugheit geführtes Leben.
Es geht hier freilich nicht um die „kleine“ Klugheit, die tendenziell egoistisch nur die Wahrung und Mehrung eigener Vorteile im Blick hat, sondern um die „große“ Klugheit, die Lebensklugheit. Klug wiederum wird man bekanntlich durch Erfahrung; und wer Erfahrung in den menschlichen Angelegenheiten hat, wird sich von extremen Verhaltensweisen fern halten. Er wird in seinem Handeln das rechte, tugendgemäße Maß finden.
Dies ist die sprichwörtliche „goldene (weil werthafte) Mitte“ zwischen einem Übermaß und einem Zuwenig. Dies garantiert mindestens die Nachhaltigkeit in Bezug auf die eigene Handlungssouveränität und ist darüber hinaus die Grundlage jeglichen personalen Wachstums.
Dies ist der Grund dafür, dass die Tugenden als ausgebildete Grundhaltungen Ausdruck eines gelungenen, weil vernunftbestimmten, glücklichen Lebens sind. In Bezug auf Ängste z. B. ist das rechte, praktisch vernünftige Maß die Tapferkeit. Der Tapfere ist nicht jemand, der gar keine Angst hat. Das ist vielmehr der Leichtsinnige oder der Draufgänger. Tapfer ist, wer sich einen solchen Umgang mit der Angst angewöhnt hat, so dass er oder sie sich von ihr warnen, aber eben genau deswegen in seinem Handeln und Leben nicht bestimmen lässt. Anders verhält sich der Feige, der habituell Ängsten aus dem Weg geht und genau deswegen ständig in der Gefahr steht, seine Handlungssouveränität zu verlieren. Oder die Leichtsinnige, die ihren Ängsten keine Beachtung schenkt oder sie unterdrückt.
In Bezug auf Lüste und Genüsse ist das rechte Maß die Besonnenheit. Der Besonnene hält sich sowohl vom übermäßigen Frönen der Lust als auch von der lustfeindlichen Selbstkasteiung fern.
Was es aber in einer bestimmten Situation heißt, tapfer oder besonnen zu sein, lässt sich wiederum nicht allgemein sagen oder in Bücher schreiben. Das Boot des Lebens muss, ja will die Kluge selber steuern, und sie wird je nach Situation, zu deren bestimmenden Faktoren auch ihre persönlichen Voraussetzungen zählen, einen Weg finden.
Keine Gebrauchsanweisungen für’s Glück
Es ist eines der Charakteristika der aristotelischen Ethik, dass sie nicht genauer sein will, als sie sein kann. Sie ist eine praktische Philosophie. Das heißt, sie will die Praxis der Menschen anleiten und kann und will daher nur umreißen (wollen), was das Gute ist. Aber bestimmen, wie es sich im Einzelfall im Handeln ausdrückt, muss ein jeder selbst.
Wäre es anders und wir hätten feste Regeln des Glückerwerbs – sozusagen Rezepte für das gelungene Leben – würden wir genau deswegen keine weiteren Erfahrungen mehr machen, unsere Klugheit könnte nicht mehr wachsen. Zum Glück zeigt sich aber, dass es Gebrauchsanweisungen für ein gelungenes Leben nicht gibt noch geben kann.
Das glückliche Leben besteht in einer vernunftgeleiteten Lebenspraxis, deren Ausdruck die Tugenden, die Bestformen der Seele sind; wer unter Glück dagegen einen Zustand versteht, den es möglichst oft und ständig zu erreichen gilt, fasst die Tugenden als Mittel zu einem Super-Zweck namens „Glück“ auf, die ihren Wert nicht aus sich selber beziehen. Eine solche Person dürfte die meiste Zeit damit beschäftigt sein, dem falsch verstandenen Glück hinter her zu rennen.
Das Glück am Rande des Weges
Geschichtlich und freilich auf einem völlig anderen Gebiet – aber dafür sehr anschaulich – zeigt diesen Unterschied das Märchen von Frau Holle: Die Goldmarie, die in den Situationen das jeweils zu Tuende realisiert – die reifen Äpfel des Apfelbaums schütteln, das fertig gebackene Brot aus dem Ofen ziehen, die Betten der Frau Holle aufschütteln, so dass es auf Erden schneien kann – dies alles sind Sinnbilder für das praktisch-tätige Leben im Sinne des Aristoteles.
Ein praxisorientiertes Leben im Sinne der Goldmarie ist glücksträchtig, weil in ihren Handlungen nicht etwas außerhalb der Tätigkeiten selbst Liegendes angestrebt wird im Sinne irgendeines Lohnes, sondern eben nur der Vollzug einer klugen und in diesem Sinne tugendhaft-nachhaltigen Praxis.
Die Pechmarie dagegen erstrebt mit ihren tugendhaft scheinenden Tätigkeiten – die äußerlich von denen der Goldmarie nicht zu unterscheiden sein mögen – einen diesen Tätigkeiten äußerlichen Zweck. Genau deswegen aber gelingt es der Pechmarie nicht, glücklich zu sein. „Gold“ im Sinne des wahren Glückes gibt es nur für die Marie, welche in ihrem Tätigsein gemäß der richtigen Haltungen Erfüllung findet, in einem Tätigsein, das situationsangemessen und daher klugheitsgeleitet ist.
Die Tugenden der Goldmarie sind dabei nicht Mittel für einen Superzweck namens Glück, sondern vielmehr Ausdruck ihrer gelungenen Lebensführung; der Lohn der Tugend bzw. Tüchtigkeit liegt in ihr selbst. Das entsprechende Glücksgefühl mag sich sodann einstellen als Symptom eines solchermaßen glücklichen Lebens. Eudaimonia ist Eupraxia, so die Lehre des Aristoteles – das Glück liegt nicht am Ende, sondern am Rande des Weges.
 Andreas Luckner ist Professor am Institut für Philosophie der Universität Stuttgart. Studium der Philosophie in Freiburg und Berlin, Promotion 1992 an der TU Berlin, Habilitation 2001 an der Universität Leipzig. Er forscht und lehrt seit 2003 in Stuttgart. Autor des Buches: Klugheit, Berlin/New York (de Gruyter) 2005
Andreas Luckner ist Professor am Institut für Philosophie der Universität Stuttgart. Studium der Philosophie in Freiburg und Berlin, Promotion 1992 an der TU Berlin, Habilitation 2001 an der Universität Leipzig. Er forscht und lehrt seit 2003 in Stuttgart. Autor des Buches: Klugheit, Berlin/New York (de Gruyter) 2005
Literaturtipp:
Aristoteles, Nikomachische Ethik, vierte Aufl. hrsg. v. Günther Bien, Hamburg (Meiner) 1985
Unsere Artikel “Basiswissen Ethik” im Überblick

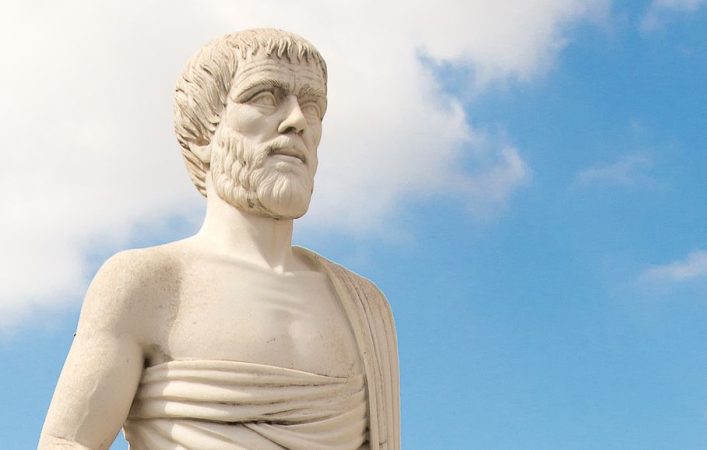






Sehr guter Artikel!
sehr gute mashalla seite