Kurzfilm über Antisemitismus an einer Berliner Schule
Lukas Nathrath (28) studierte Filmregie. „Kippa“ ist sein Abschlussfilm. Im Zentrum des Kurzfilms steht der jüdische Schüler Oskar, der zwei Jahre lang an einer Berliner Schule gemobbt und attackiert wird. Hilfe erfährt er nicht. Eine Geschichte über Wegsehen und Leugnen, die auf wahren Begebenheiten beruht.
Der Filmemacher Lukas Nathrath (28) studierte an der Hamburg Media School im Masterstudiengang Filmregie. 2019 stellte er seinen Abschlussfilm „Kippa“ vor. Er basiert auf der wahren Geschichte Oskars, der an der Berliner Gemeinschaftsschule Friedenau wegen seiner jüdischen Identität gemobbt wurde. Das war 2016 und 2017. Doch auch heute noch ist das Thema Antisemitismus mehr denn je aktuell. Deshalb hat Nathrath diesen Kurzfilm gemacht.
Die Handlung beruht auf dem, was sich in Berlin-Friedenau zugetragen hat: Oskar, im Film 15 Jahre alt, ist ein jüdischer Junge, der über Monate beleidigt und massiv körperlich angegriffen wurde. Er ist die Hauptfigur im Film.
Die Gewalt gegen ihn eskalierte mit einer gestellten Erschießung und körperlichen Attacken, wie dem Abschnüren der Luft – unter anderem von arabisch- und türkischstämmigen Mitschülern. Ihre Begründung: Oskar sei Jude. So sagen es die Darsteller auch im Film. Weiter wurde er immer wieder mit der Politik Israels gegenüber den Palästinensern konfrontiert.
Der nur 26-minütige Film zeigt die brutale Gewalt und das Versagen der Verantwortlichen in der Schule: Die Lehrerinnen und Lehrer greifen zu spät ein. Antisemitismus wird verharmlost und verleugnet. Denn welche Schule wird schon gern mit Antisemitismus in Verbindung gebracht? Keiner positioniert sich, viele schauen einfach weg, manche aus Angst, manch andere, weil er die Kritik an der Regierung Israels toleriert und das Mobbing rechtfertigt.
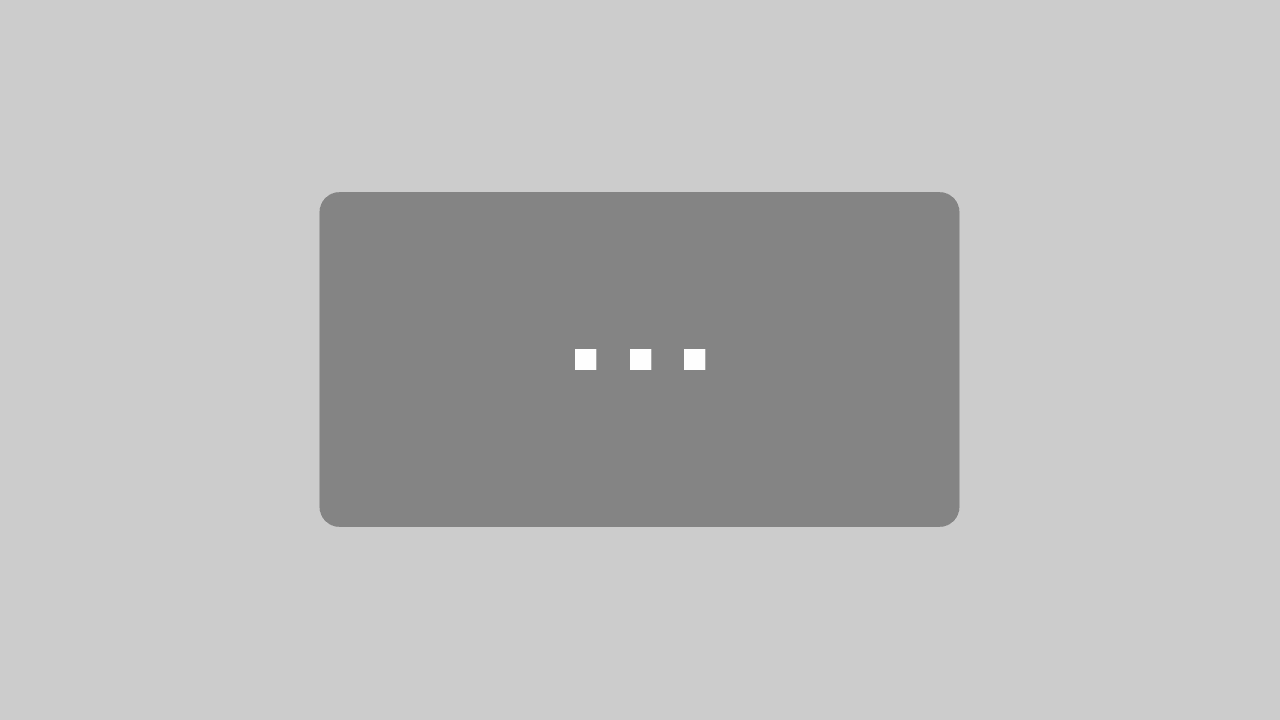
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Schockierende Erfahrungen an der Schule
2017 wechselte Oskar die Schule. Seine Mutter hat in einem Dossier der Wochenzeitung „Die Zeit“ im Januar 2018 eindrücklich von diesem Mechanismus an Schulen berichtet: „Als Oskar das erste Mal erzählte, wie seine Mitschüler ihn behandeln, dachte ich: Die müssen nur mehr über uns erfahren. Wir haben dann mit der Lehrerin abgesprochen, dass Oskars Großeltern – sie sind Holocaust-Überlebende – die Schule besuchen und von sich erzählen. Danach aber gingen die Angriffe weiter. Je schlimmer es wurde, desto mehr habe ich das Gespräch gesucht: Die Lehrerin war aufgeschlossen, doch die Schulsozialarbeiterin suchte den Fehler bei Oskar. Der Schulleiter ließ sich ständig verleugnen. Am Ende blieb uns nur, Oskar von der Schule zu nehmen. Diese Erfahrung, dass niemand bereit war einzuschreiten, hat mich schockiert.“ (1)
Der Film von Lukas Nathrath geht sehr nah, weil er das, was Oskar erlebt, schonungslos nacherzählt – mit gestellten Szenen und in sehr dichter Atmosphäre. Der junge Regisseur hat mittlerweile einige Preise gewonnen, darunter den Studio Hamburg-Nachwuchspreis und den CIVIS – Europas Medienpreis für Integration. Zur Zeit ist Nathrath damit auf verschiedenen internationalen Kurzfilmfestivals unterwegs und wird für Schulvorführungen angefragt. Im Jahr 2020 soll der Film im NDR gezeigt werden.
Vorausgegangen ist der Produktion eine Recherchearbeit, die die Situation anhand individueller Geschichten von Antisemitismus in Deutschland faktisch und wahrhaftig dokumentiert. Daraus entstand eine Reportage, die Anfang 2019 im Fernsehsender Phönix lief.
Empathie für die Opfer von Antisemitismus
Nathrath selbst hat vor allem erschüttert, dass der offensichtliche Antisemitismus an der Schule nicht offen thematisiert wurde. Die Täter hätten einen Migrationshintergrund, auch das mag ein Grund für die falsche Zurückhaltung sein.

„Das Totschweigen hat die Sache noch schlimmer gemacht,“ so Nathrath. Dann nach Bekanntwerden des Vorfalls und des Täterhintergrunds hätten plötzlich rechtspopulistische, islamophobe Stimmen aus der AfD Solidarität mit den Juden bekundet. Dabei sei ihr einziges Motiv, Ressentiments gegen Migranten zu schüren. „Wenn man sich nicht traut, die Situation klar zu benennen, ist das nur Wasser auf die Mühlen der Falschen“.
Was motivierte den Studenten, den Film zu drehen? „Ich wollte mit meinen erzählerischen und visuellen Mitteln ein gesellschaftspolitisches Ereignis emotional begreifbar machen”. Die aufgeladene emotionale Situation um Oskar berührt den Zuschauer unmittelbar. „Das ist wichtig, weil Antisemitismus keine Theorie ist, sondern konkretes Erleben,“ so Nathrath nachdenklich. Das habe schon die Wirkung anderer Stoffe gezeigt, etwa die der US-amerikanischen Serie Holocaust, die Ende der 1970er in Deutschland zu sehen war. Hier wurde zum ersten Mal in Form einer filmischen Story gezeigt, was davor nur in Geschichtsbüchern zu lesen war.
Für Nathrath lässt sich die Geschichte von Oskar auch auf Schule heute übertragen, das merkt er besonders an den Reaktionen bei Schulvorführungen. Es geht um Gruppendruck und Ausgrenzung, Freundschaft und Verrat. Anderssein und Ausgrenzung erleben viele an den Schulen, und allzu oft gleiten solche Erfahrungen in Mobbing über. Wenn sich eine Gruppe zusammentut und gegen Einzelne agiert, gibt es kaum noch Hemmungen.
Auch Muslimas, die ihr Kopftuch an Schulen tragen, erlebten manchmal Ausgrenzung, so Nathrath. Das Symbol, mit dem sie einen Teil ihrer Identität ausdrücken, macht sie angreifbar. Oskar trägt in dem Film gegen alle Widerstände seine Kippa.
„Ich wünsche mir, dass dieser Film bei aller Tragik Kraft gibt, zu seiner Identität zu stehen“, fasst Nathrath seine Botschaft zusammen. Vielleicht stärkt er bei Schülerinnen und Schülern auch die Kraft, Empathie für jemanden zu finden, mit dem sie sich sonst nie beschäftigen würden. Und zu erkennen, dass er das gleiche empfindet wie sie selbst, wenn ihre Identität bedroht wird.
Stefan Ringstorff
Lesen Sie auch: Antisemitische Vorfälle nehmen zu – Die Lage 2019
Mehr zum Film auf der Seite der Hamburg Media School
Wenn Sie an einer Schulaufführung des Films interessiert sind, nehmen Sie bitte Kontakt zu Petra Barkhausen von der Hamburg Media School auf, Telefon: +49 (0)40-413-468-61, E-Mail: p.barkhausen@hamburgmediaschool.com







