Das Engagement von Burak Yilmaz gegen Antisemitismus
Im Zuge des Krieges im Nahen Osten hat die antisemitische Gewalt zugenommen, Verständigung ist schwierig. Der Pädagoge Burak Yilmaz, Sohn türkischer Einwanderer, reist mit jungen Muslimen zur KZ-Gedankstätte nach Ausschwitz und schafft Begegnungen zwischen Muslimen und Juden. Geschichte wird plötzlich Teil der eigenen Biografie.
Für Yilmaz ist der Nahostkonflikt seit seiner Jugend präsent. In der Familie und im Freundeskreis wurde über die palästinensische Sache und den Wunsch nach Frieden und einer Zweistaatenlösung gesprochen.
Später, als Yilmaz in einem Jugendzentrum arbeitete, betreute er palästinensische Jugendliche und Familien, hörte ihre Geschichten und ihr Leid, gab ihnen Raum für die Trauer.
Dann entstand in ihm die Idee, auch die Geschichten der anderen Seite zu hören. Yilmaz lud palästinensische und israelische Referenten ins Jugendzentrum ein. „Diese Gespräche haben uns beflügelt, weil alle sehr bewegt waren und die Jugendlichen sich darauf einließen“, sagt Yilmaz.
Antisemitismus verbindet Rechtsextreme und Islamisten
Im Zuge dieser Gespräche merkte er auch, dass gerade in Deutschland der Nahostkonflikt ein Tabuthema ist. „Man versucht, das Thema von sich zu weisen. Auch in der Schule gibt es nicht die Gelegenheit, darüber zu reden“, beobachtete er.
In seinem Jugendzentrum schuf er Räume für solche Gespräche, erlebte aber auch die hasserfüllte Dynamik dieses Konflikts. Yilmaz berichtet von einer prägenden Erfahrung im Jahre 2009, als in Duisburg eine Anti-Israel Demo stattfand, die antisemitisch eskalierte.

Der Demonstrationszug blieb vor einem Gebäude stehen, wo in einer Wohnung eine Israelfahne am Fenster hing. Die Menge wollte das Gebäude stürmen.
Da brach die Polizei die Wohnungstür auf und entfernte die Israelfahne. „Der Mob unten auf der Straße jubelte. Das war ein Tabubruch in meiner Stadt“, war Yilmaz entsetzt. Auch Jugendliche aus seinem Jugendzentrum waren auf der Demo und kamen völlig aufgeheizt zu ihm.
„Da war ich zum ersten Mal vertiefter damit konfrontiert, welche Dynamiken solche Demonstrationen auslösen können. Bei dieser Demo sind Islamisten, türkische Nationalisten, linke Antiimperialisten und deutsche Rechtsextreme gemeinsam mitgelaufen, also eigentlich Gruppen, die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen müssten.“
Yilmaz merkte, dass der Antisemitismus verfeindete Lager verbindet. Das war der Anlass für ihn, mit den Jugendlichen über Judenhass, Antisemitismus und die deutsche Geschichte zu sprechen. Aber bald reichten ihm Gespräche nicht mehr aus.
Plötzlich ist Geschichte nicht mehr abstrakt.
Der Auslöser war eine Erfahrung im Jahre 2012. Muslimische Jugendliche in seinem Jugendzentrum wurden von ihrer Schule von der Fahrt zur KZ-Gedenkstätte Auschwitz ausgeschlossen. In der Schule dachte man, dass sie muslimisch und deshalb per se antisemitisch seien.
„Ich war völlig entsetzt. Aus meiner spontanen Reaktion heraus habe ich gesagt: Ja, dann fahren wir halt übers Jugendzentrum hin.“
Die jungen Muslime wollten diese Orte besuchen und sich mit der Geschichte auseinandersetzen.
Aber was durch den Besuch in Auschwitz ausgelöst wird, konnte Yilmaz, der selbst noch nie eine Holocaust-Gedenkstätte gesehen hatte, nicht erahnen. So wurde aus einer spontanen Idee ein großes Projekt, das er sieben Jahre lang intensiv begleitete.
In der Vorbereitung beschäftigten sich die Jugendlichen mit ihrer eigenen Familiengeschichte: Wann sind unsere Großeltern nach Deutschland gekommen? Mit welcher Motivation? Auf was für eine Gesellschaft sind die gestoßen?
Einer meinte: „Bevor wir diese Biographiearbeit gemacht haben, war Geschichte immer so was Abstraktes. Wie ein Flugzeug, das irgendwo 10.000 Kilometer weit oben am Himmel fliegt. Aber auf einmal kracht dieses Flugzeug in deine eigene Biografie. Die eigene Familiengeschichte zeigt eigentlich am direktesten die Auswirkungen von geschichtlichen Ereignissen.“
Yilmaz erforschte mit den Jugendlichen auch die Geschichte ihrer Heimatstadt: In was für einem Teil von Duisburg leben wir eigentlich? Wie sah es hier zwischen 1933 und 1945 aus?
So entdeckten sie gemeinsam die Geschichten der jüdischen Menschen. Sie fanden heraus, dass in Duisburg-Marxloh in der Pogromnacht des 9. Novembers 150 Jüdinnen und Juden aus dem Schlaf gerissen und sofort nach Dachau deportiert wurden. Staatlich organisiert und mit einem massiven Aufgebot der Polizei.
In der KZ-Gedenkstätte erleben junge Muslime einen Schock
Die Reise zur Gedenkstätte hat die Jugendlichen berührt und einschneidend verändert. Mehmet erklärt: „Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so schockt. Weil ich deutsch bin und meine Eltern einen arabischen Migrationshintergrund haben, dachte ich, ich könnte besser damit umgehen.“
Und Abdul sagt: „Viele Verschwörungstheorien über Juden scheinen irgendwie plausibel, aber wenn man hier ist, ist es sehr schwer, noch was zu leugnen.“
Die Jugendlichen lernten dort auch Israelis in ihrem Alter kennen, die sich aus einer völlig anderen Perspektive mit dieser Geschichte befassen. Sie hatten Fotos von ihren Großeltern dabei, die in Auschwitz ermordet wurden. Das war ein Perspektivwechsel, den sie alle dort das erste Mal wirklich vollzogen haben: Was bedeutet diese Geschichte eigentlich für Menschen, die ihre Familienangehörigen im Holocaust verloren haben?
Nach den Fahrten wollte Yilmaz diese Erweiterung der Perspektive unterstützen. Er kam auf die Idee, gemeinsam mit den Jugendlichen Theaterstücke zu entwickeln. Sie schrieben die Stücke gemeinsam, aus ihren eigenen Erfahrungen und Emotionen. Zugleich konnten sie auf der Bühne erfahren, dass sie etwas bewirken können und dass das, was sie lernen und was sie erfahren haben, Kreise zieht.
Kunst kann die Zivilcourage stärken
Besonders die Vermittlung dieser Themen durch Kunst bewegte viele Menschen. „Ich habe immer wieder gemerkt“, so Yilmaz, „wenn ich an Schulen Vorträge über Antisemitismus halte, ist es etwas ganz anderes als ein Theaterstück zu spielen. Wenn man eine hoch emotionale Familiengeschichte erzählt, sind die Menschen berührt. Es eine Möglichkeit, die Sprachlosigkeit hinter sich zu lassen und eine Sprache für diese Themen zu finden und auf die Bühne zu bringen.“
Bei den Vorstellungen beindruckte Yilmaz am meisten die Stille im Publikum. Von vielen Lehrkräften hörte er, dass sie ihre Schülerinnen und Schüler noch nie so konzentriert erlebt hatten.
Viele sagten hinterher: ‚Boah, ich kenne das von meinem Fußballverein, von meiner Familie, vom Freundeskreis, dass man das so hinnimmt, wenn jemand antisemitische Sachen von sich gibt, dass man da nicht einschreitet.“ Drei Jahre tourte die Gruppe mit dem Stück „Benjamin und Muhammed“ durch Deutschland.
Für die Jugendlichen hat sich durch diese Erfahrungen viel verändert. Emre sagt: „Ich glaube, wir sind jetzt so weit, wenn wir Antisemitismus, Sexismus oder Rassismus oder andere Diskriminierungsformen sehen, dann würden wir das so benennen. Und dann auch eingreifen.“
Und da sie selbst aus einer Minderheit kommen, entwickeln sie auch die Vision einer gegenseitigen Unterstützung mit jüdischen Menschen. Wie es Emre ausdrückt: „Es ist einfach wichtig, Solidarität zu zeigen. Wir sind eine Minderheit, die sich für eine Minderheit einsetzt. Es beruht einfach alles auf Gegenseitigkeit.“
Und Merve erklärt: „Vor allem würde ich mir mehr Zusammenarbeit dieser Minderheiten wünschen, dass man sich gemeinsam für gute Sachen einsetzt und sich nicht gegenseitig mit Dreck bewirft.“
Aufgrund dieser Veränderung in der Perspektive und dem Denken der Beteiligten, sind für Baruk Yilmaz neben seiner Vortragstätigkeit solche pädagogischen, kreativen Projekte ein besonderes Anliegen. Im Januar 2024 startete er mit der Arbeit an einem neuen Theaterstück.
Mike Kauschke
Lesen Sie auch das Interview mit Burak Yilmaz: “Wir müssen die offene Gesellschaft gegen Islamisten und Rechtsextreme verteidigen”
Weitere Infos:
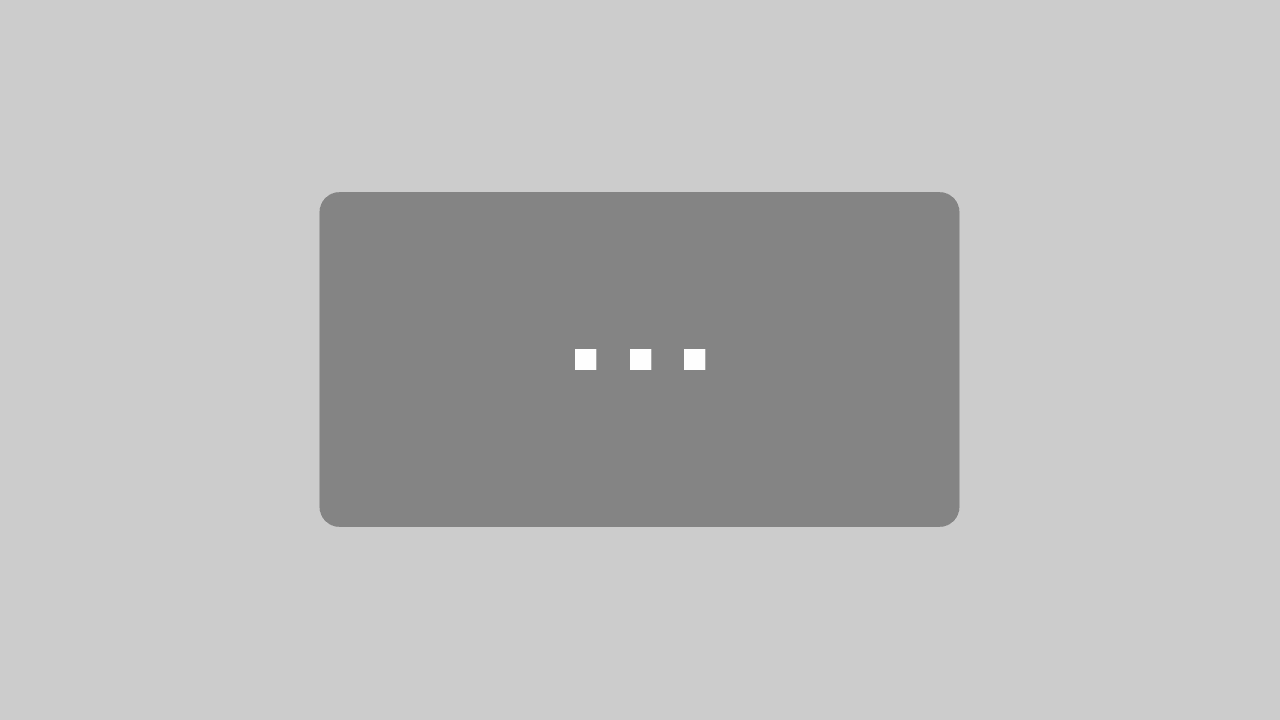
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren







