Regisseur Peter Konwitschny im Portrait
Starregisseur Peter Konwitschny will Menschen berühren und bilden. Sein Musiktheater vermittelt ethische Werte und fördert Empathie. Anja Oeck über den unangepassten Regisseur, der eine aalglatte Performance ablehnt. Vielmehr will er die humanistische Essenz, die in den Stücken steckt, herauskristallisieren.
Sein Musiktheater sieht Regisseur Peter Konwitschny als eines, das seit den alten Griechen in einer anhaltenden Tradition unmittelbarer, Werte bildender Kunst steht. Genauso ist es aber auch von Bertolt Brecht und dessen epischem Theater inspiriert. Es werden Geschichten erzählt, die unmittelbar berühren. Denn Konwitschny arbeitet für die Menschen.
Mit seinem humanistischen Theater will er vermeiden, dass Kunst die Menschen voneinander – und vor allem von sich selbst – entfremdet. Als Werte bildende Institution sieht er analoges Theater als weitaus besser geeignet an als beispielsweise Fernsehen.

Konwitschny: „Wenn in einem Stück auf der Bühne ein Mensch einem anderen mit Stiefeln ins Gesicht tritt, dann ist die Wirkung eine andere, als wenn ich das im Fernsehen gesehen oder gelesen habe.“ Mit seinen Inszenierungen möchte er den Zuschauern die Eigenverantwortung nahe legen, sie animieren, selbst zu denken und zu fühlen. Und um Himmels willen nicht Moden oder – oftmals falschen – Autoritäten, wie zum Beispiel Stars, Politikern, aber auch der Presse ungeprüft vertrauen!
Der Opernregisseur Peter Konwitschny, geboren 1945 in Frankfurt am Main, ist Sohn des Leipziger Gewandthauskapellmeisters und bekannten Dirigenten Franz Konwitschny und dessen Frau Anny, die ihre Karriere als Sängerin zugunsten des Mannes an den Nagel hängte. Nach dem Abitur in Leipzig wollte er zunächst Physik studieren und dann dem Vater als Dirigent nacheifern. Letztendlich kam er über das Berliner Ensemble sowie dessen Intendantin und Regisseurin Ruth Berghaus zur Regie.
Heute zählt er zu den wenigen weit im Voraus angefragten Opernregisseuren weltweit mit vollem Terminkalender bis 2020. Als bisher einziger Opernregisseur wurde er fünfmal „Regisseur des Jahres“ der Zeitschrift Opernwelt. 2016 bekam er den deutschen Theaterpreis „Der Faust“ für seine Inszenierung von Halévys „La Juive/Die Jüdin“, s. Trailor.
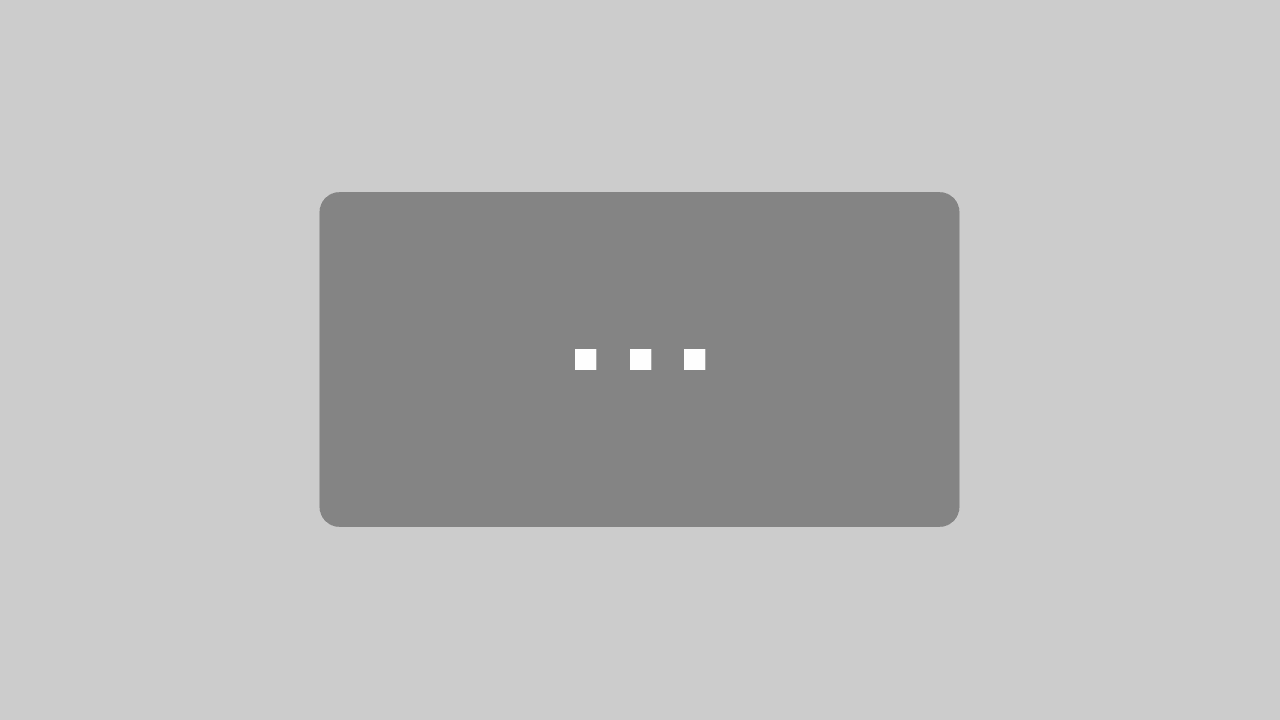
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Humanistisches Theater
Peter Konwitschny trat von Anfang an für die Vermittlung humanistischer Werte in der Kunst ein. So manches Engagement brach er ab – auch in Zeiten, in denen er es sich als noch unbekannter Regisseur eigentlich nicht hätte leisten können. Warum? Aus Überzeugung. Peter Konwitschny: „Ich kann ‘Aida’ so inszenieren, dass die Leute hinterher sagen: ‘Mensch, der Tenor hat ja toll gesungen’. Ich kann aber auch so inszenieren, dass sie sagen: ‘Er hat gut gesungen. Aber der ist doch wohl nicht ganz bei Trost, seiner Freundin vorzuschlagen, nur noch eine Schlacht gegen ihr Volk zu gewinnen und dann seinen König zu bitten, sie heiraten zu dürfen’. Dass in ‘Aida’ gut gesungen wird, ist Voraussetzung und hat nur den Sinn, die für die Gesellschaft relevanten politischen und ethischen Botschaften zu verstärken.”
Peter Konwitschny protestiert, wenn die Bedingungen für gesellschaftlich relevantes, engagiertes Musiktheater nicht gegeben sind. Das machte ihn bereits in jungen Jahren in der damaligen DDR zu einem unangepassten Künstler. Er widersetzte sich Regimen oder Intendanten, die ihn zu totem Theater zwingen wollten.
Konwitschnys Blickwinkel auf besonders drei Komponisten war bahnbrechend und schuf eine eigene Rezeptionsgeschichte: Seine Interpretationen der Händelopern „Floridante“, „Rinaldo“, “Aci Galatea e Poliemo” und „Tamerlano“ erlangten internationale Bedeutung und schufen eine neue Ära der Händelpflege in Halle. Seine Herangehensweise an „Aida“, „Attila” oder „Don Carlos“ von Giuseppe Verdi, vor allem aber seine progressive Sicht auf Richard Wagners Musikdramen „Lohengrin“, “Parsifal” „Tristan und Isolde“, „Götterdämmerung“ oder „Meistersinger“ eröffnete eine ganz neue Auseinandersetzung mit diesen beiden Hauptakteuren unserer Opernspielpläne.
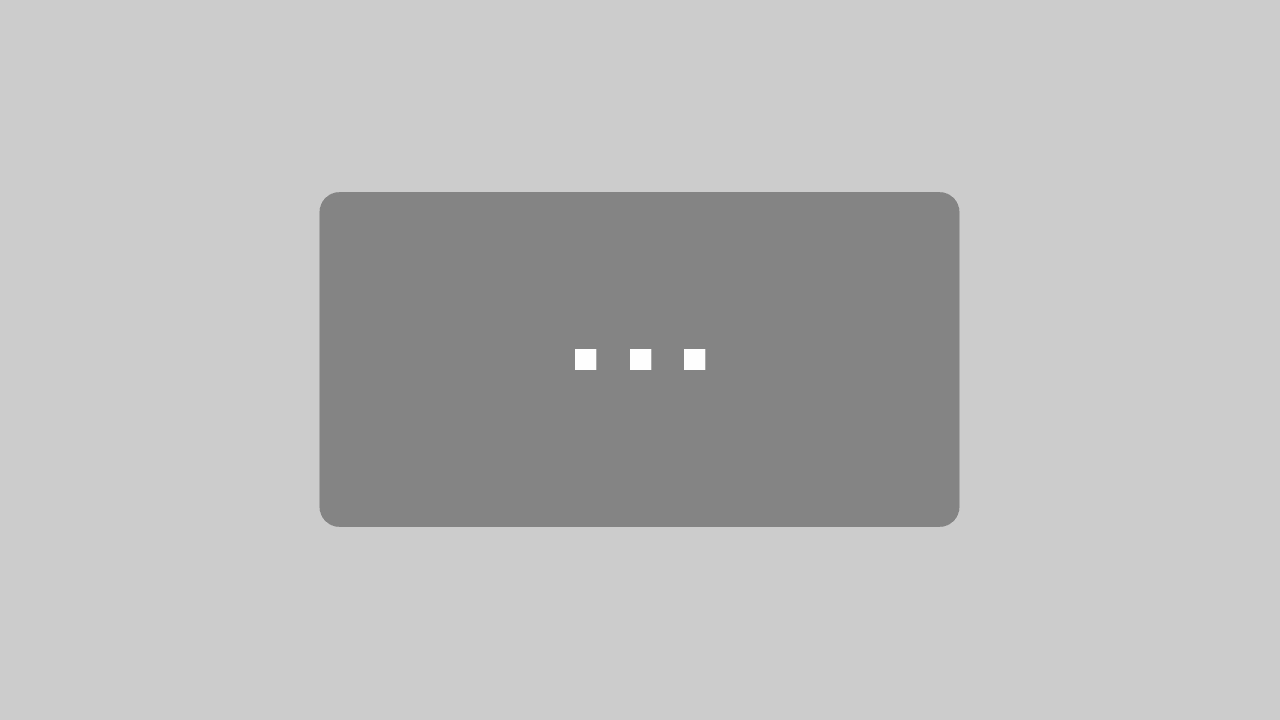
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Wider das tote Theater
Was aber unterscheidet Konwitschnys Schaffen von dem anderer Regisseure? Was war und ist auf vielen Opernbühnen noch gang und gäbe? Es ist die Haltung, mit der an die Stücke und an die Arbeit mit den Sängern herangegangen wird. Die Haltung zum Gegenstand, dem Werk. Das Wichtigste ist, was zwischen den Menschen passiert, was sie voneinander wollen und wie sie das machen. Perfektionismus ist der Ersatz dafür.
So mancher Sänger meint, um seinen Job nicht zu riskieren, die Gesangspartie perfekt „abliefern“ zu müssen. Sein direkter Boss ist der musikalische Leiter. Und, je nach ästhetischem Ideal, verlangt dieser dass Ton für Ton wohlgeformt sitzt. So achten viele Sänger dementsprechend vor allem darauf, von ihrer Position auf der Bühne gut gehört zu werden, den Dirigenten sehen zu können, um ihren Einsatz nicht zu verpassen, und allzu anstrengende Aktionen zu vermeiden. Regieanweisungen, die ihrem Singen abträglich scheinen, gelten dann eher als Hindernis. Alles adrett und schön also. Von der eigentlichen Geschichte des Stücks bekommt man bei solchen Aufführungen allerdings nicht viel mit.

„Prima la musica, poi le parole: Zuerst die Musik, dann der Text“: Die seit dem 18. Jahrhundert etablierte Reihenfolge zwischen Musik und Regie gilt heute nicht mehr uneingeschränkt: Inzwischen versuchen auch im Musiktheater Regisseure vermehrt, den Sinn der Werke zu vermitteln. Was aber bedeutet das für den Regisseur, wenn er Sänger zu authentischem Spiel anleiten möchte?
So viel ist klar: Bei Konwitschny stehen keine Gesangsdiven beziehungslos nebeneinander und liefern mit starrem Blick auf den Dirigenten saubere Töne ab. Das wäre für ihn der Inbegriff von totem Theater: „Wenn perfekt gesungen wird, was der Tod ist, nicht wahrhaftig, wenn ich also im Gesang nicht spüre, dass jemand verzweifelt ist und klingt, dann ist das der Verrat an der Möglichkeit, mit Theater Empathie zu üben.“
Wagner mal anders
Peter Konwitschny bürstet die Stücke gegen den Strich. Aber nicht, indem er ihnen einfach etwas Fremdes, rein Äußerliches überstülpt, sondern indem er die humanistische Essenz jedes einzelnen Werks herauskristallisiert: Er zeigt Frauen als empathische Wesen, selbst wenn sie von Männern dominiert oder gar erniedrigt werden. Er tritt für Ausgegrenzte und Unterdrückte ein, von denen große Opern wie Verdis „La Traviata“, Wagners „Meistersinger“ oder Mozarts „Don Giovanni“ handeln. Er macht angebliche Versager wie den Jägerburschen Max in von Webers „Freischütz“ oder Moses in Schönbergs Opernfragment „Moses und Aron“ zu positiven Figuren. “Die Komponisten sind immer auf der Seite der Opfer,” so Konwitschny.
Er untersucht die Stücke auf essentielle Fragen des Miteinanders und verteidigt die Opernstoffe mit ihren eigenen Kräften gegen eine eindimensionale Rezeption. Im Regieteam mit einem Dramaturgen, musikalischen Leiter, einem Bühnen- und Kostümbildner, hinterfragt er in oft endlosen Sitzungen, lange bevor die Proben mit den Darstellern beginnen, was in den Stücken steckt. Und da ist zunächst jede Idee willkommen. Bis schließlich ein schlüssiges Konzept entwickelt ist, herrscht kreative Gleichberechtigung. Dessen Umsetzung liegt bei den Proben mit den Sängern dann in Konwitschnys Hand.
Mancher gebildete Operngänger mag da nun fragen: „Warum aber „Lohengrin“ im Klassenzimmer? Ich will ihn so sehen, wie er zu Wagners Zeiten gespielt wurde. Wer soll so was verstehen?“ Ein Blick ins Libretto (Text der Oper) und die Partitur hilft. Konwitschnys Team arbeitet heraus, dass da Unreife, Infantile, ja Unzurechnungsfähige miteinander verhandeln. Da wird in den Krieg gestürmt, als wäre es ein Kinderspiel.
So entstand das Bild von pubertierenden Schülern, die mit Holzschwertern Krieg spielen, sich in den Schulbänken kappeln, Schwache necken, Mitschüler, die nicht dazu gehören, hänseln, bevor die Autorität Lehrer hereinkommt. Das alles entwickelt sich weiter, es bleibt nicht dabei… Dies schafft einen Anknüpfungspunkt an eine vertraute Situation, denn jeder Zuschauer hat schon mal die Schulbank gedrückt. Und auf einmal ist man mitten drin. Mitten im Stück und gleichzeitig bei sich selbst.
Eintauchen in eigene Erlebnisse
Heute in Zeiten eines Regietheaters jeglicher Couleur mag dies als selbstverständlich erscheinen. Ist es aber nicht! So manche Inszenierung bleibt bei irgendeiner Idee stecken, die sich aber keineswegs mit dem Werk einlösen lässt. Dann spürt der Zuschauer, dass da etwas Gewolltes irgendwie nicht passt.
Im Gegensatz dazu entwickelte Peter Konwitschny bereits in den 70er Jahren, als das Regietheater noch nicht so in Mode war, seine Konzepte mithilfe der Partitur – und eben nicht willkürlich gegen das Werk. Dem ist er bis heute treu geblieben. Er erzählt mit seinen Figuren immer noch von fühlbaren Menschen und schafft es immer wieder, auch seine Mitarbeiter davon zu begeistern.
So können wir als Zuschauer durch diese Werke in unsere Geschichten und eigene Erlebnisse eintauchen und uns selbst näher kommen. Auf die Frage, woran er erkennen kann, dass seine Inszenierung bei den Menschen ankommt, meint Konwitschny: „Eigentlich nur durch die Resonanz der Mitarbeiter. Von der Presse sowieso nicht mehr. Und auch die sogenannte Fan-Gemeinde, die ich ja inzwischen habe, auch da kann es kurios werden, wenn ich dem allen glaube. Bei den Mitarbeiter, und das betrifft auch die Techniker, da spüre ich am deutlichsten, ob etwas bei ihnen ankommt und was zurück kommt.“
Anja Oeck
Anja Oeck, freie Mitarbeiterin von Ethik heute, Autorin, Redakteurin und Dramaturgin. 2008 erschien bei der Akademie der Künste in Berlin ihr Buch: „Musiktheater als Chance. Peter Konwitschny inszeniert“.
Hören Sie auch ein Interview mit Peter Konwitschny
Die nächsten Termine von Konwitschny-Inszenierungen:
Ab 7. April 2017 in Bratislava: „La Juive“ (Halévy)
Ab 24. Juni 2017 in Nürnberg: „Attila“ (Verdi)
Ab 15. Oktober 2017 in Bonn: „Penthesilea“ (Schoeck)







